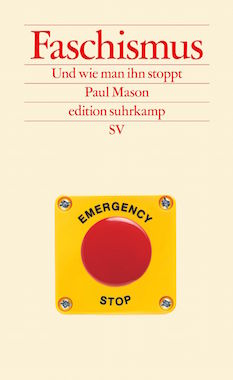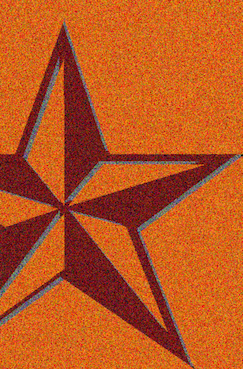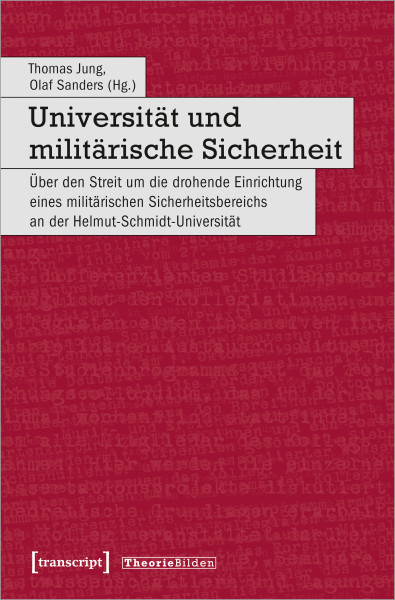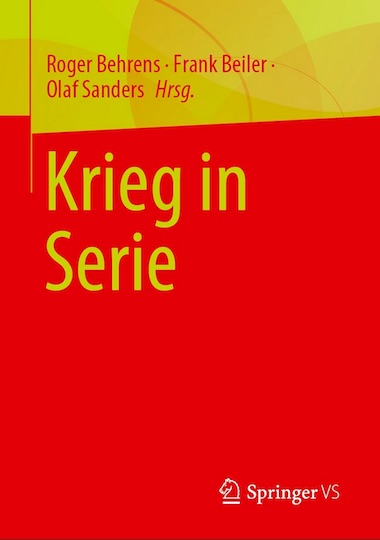Neu!
Christoph Dallach, ›Future Sounds. Wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten‹, Suhrkamp Verlag: Berlin 2021, 511 S. brosch. (95)
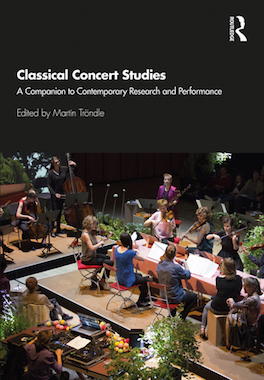
… and tell Tchaikovsky the News
Im Januar 2021 erschienen: Martin Tröndle (Hg.), ›Classical Concert Studies. A Companion to Contemporary Research and Performance‹, Routledge: London und New York 2021.
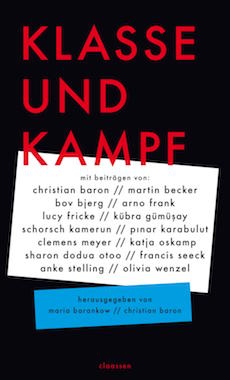
Klasse und Kampf
Christian Baron & Maria Barankow (Hg.), ›Klasse und Kampf‹, Claassen: Berlin 2021, 224 S. geb. Von der Verlagsseite: »Was bedeutet es, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen? Zur „Unterschicht“ zu gehören und dafür ausgelacht und ausgegrenzt zu werden? Sich von seinem Herkunftsmilieu zu entfernen, aber die eigenen Wurzeln nicht verraten zu wollen? Und dennoch im neuen Milieu …
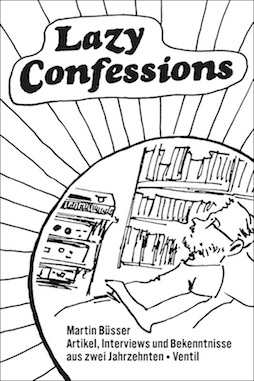
Faule Bekenntnisse
Martin Büsser, ›Lazy Confessions. Artikel, Interviews und Bekenntnisse aus zwei Jahrzehnten‹, Ventil Verlag: Mainz 2020, 280 S. brosch. (66)
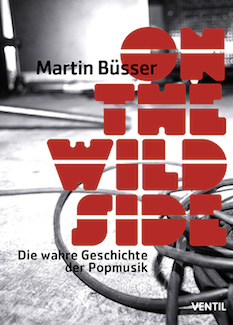
Von der wilden Seite der Geschichte
»Jimi Hendrix ist unmittelbar mit den 68ern verbunden, Punk mit den sozialen Umständen im Großbritannien der ausgehenden Siebziger. Die Zeitumstände machen Musik nicht nur spannend, sondern überhaupt erst verständlich. In der heutigen, von Zitaten nur so durchdrungenen Popmusik gilt deshalb mehr denn je: Wer die Musik verstehen will, muss auch ihre Vergangenheit kennen.« Martin Büsser, ›On the Wild …
Pop & Populismus (Notiz)
Erstens. – Populismus unterstellt ein authentisches Volk, ein echtes Gemeinschaftsinteresse bzw. das echte Interesse der Gemeinschaft (nämlich das authentische Interesse der Gemeinschaft an sich selbst). Zweitens. – Volk, Gemeinschaft und Gemeinschaftsinteresse sind ideologische Figurationen, die sich mit der Moderne bzw. dem bürgerlichen Zeitalter (mit und nach der französischen Revolution 1789) etabliert haben. Das heißt: ein auf Volk und …
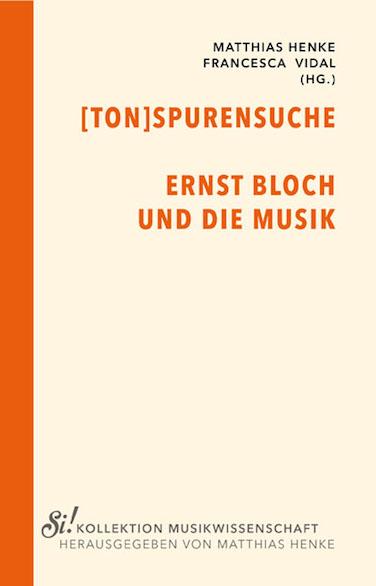
Tonspurensuche
Als Blochs Hauptwerk ›Das Prinzip Hoffnung‹ in drei Bänden 1954, 1955 und 1959 erscheint, konstituiert sich eine neue Kultur, die sich programmatisch auf die Zukunft richtet: Ausgehend von der (britischen) Pop-Art entwickelt sich die Popkultur (initiale Ausstellung in London 1956: ›This is Tomorrow‹); Musik – Rock ’n’ Roll, Soul, ergo Popmusik – wird schnell zur neuen Leitkunst. In Blochs Philosophie schimmert einiges an Motiven durch, die sich auch im Pop und der Popmusik wiederfinden lassen – zumindest wenn man sich drauf einlässt, diese Motive auch zu finden, zumal in Hinblick auf das Grundmotiv Hoffnung. Mithin ist dieses Sich-Einlassen gerade deshalb möglich, weil das Verhältnis von Bloch und Pop mehr als disparat bleibt – ja, tatsächlich haben Bloch und Pop wenig miteinander zu tun (gehabt), schließlich gar nichts, was die Popmusik angeht. Der Beitrag versucht allerdings nichtsdestotrotz Ernst Blochs Philosophie, auch Musikphilosophie, mit Pop und Popmusik zusammenzubringen – oder wenigstens zusammen zu hören.

Schöne Ghettowelt
Rassismus, Antisemitismus, Ressentiments definieren eine politische Normalität, die nicht länger auf Konzepte der Agitation und Aufklärung vertrauen lässt. Was Anfang der Neunziger schon als gescheitertes Programm der allerletzten K-Gruppen feststand und mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus unterging, hat sich in den vergangenen zehn Jahren auch als kulturelles Modell erledigt: In der neuen Mitte hat sich das Dumpfe eingerichtet, ein Sozialcharakter, der seine psychohistorische Parallele hat: ›Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches‹. Unter der Oberfläche sozialistischer, auch antifaschistischer Politik war bereits 1932 ein autoritärer wie ohnmächtiger Konformismus zu verzeichnen. Von »zynischer Sachlichkeit« spricht Marcuse später in seinen ›Feindanalysen‹ über Nazideutschland. Als Triebstruktur hat sich dieses System länsgt wieder etabliert, die ›Diktatur der Angepassten‹ nannten es Blumfeld auf dem Album ›Testament der Angst‹.