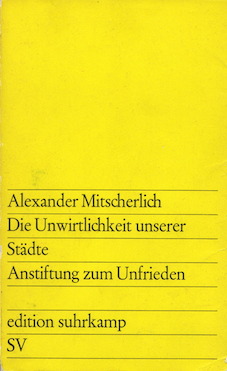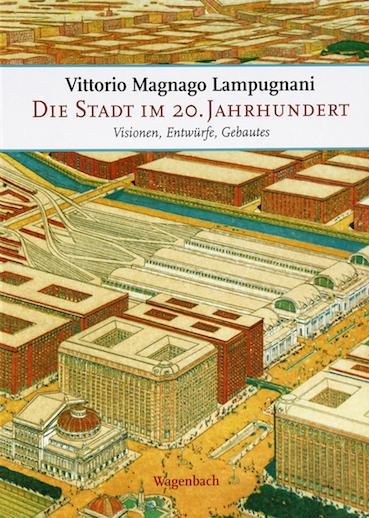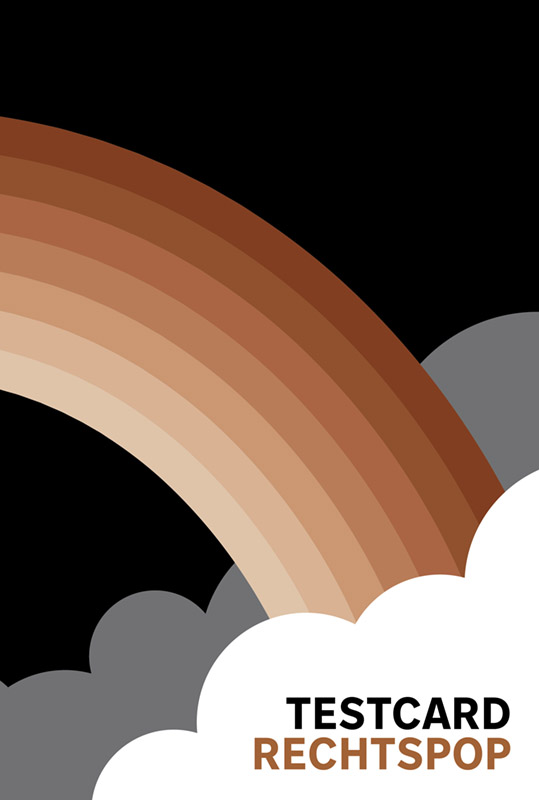Zurück zum Beton
Vor dreißig Jahren, neunzehnhundertfünfundachtzig, veröffentlicht Alexander Kluge das Drehbuch zu seinem 27. Film: ›Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit‹. Der Titel, schreibt Kluge, sei »ein vorläufiger Arbeitstitel«, der Film könne auch heißen: »Das Kino und die Illusion der Stadt«.1) Es gehe um individuelle Lebenswege, die sich – zufällig – überkreuzen, um Begegnungen in der Großstadt, exemplarisch für das Schicksal der Menschheit am Ende des von Unmenschlichkeit geprägten zwanzigsten Jahrhunderts, so Kluge. Er notiert dazu: »Es gibt ein Versprechen, bestehend aus umbautem Raum. Dieses Versprechen ist etwa 8000 Jahre alt: die Großstadt.«2) Das ist im Film Frankfurt am Main. Weiter heißt es: »In den letzten Jahren waren unsere Großstädte … im Umbau begriffen: U-Bahnen, B-Ebenen, neue Stadtzentren, Fußgängerzonen werden errichtet. Dieser Umbau ist für viele Menschen von der Illusion begleitet, dass er immer weiter führt, solange bis für unseren menschlichen Geschmack passende Städte dabei herauskommen, die dem Idol der vielgeschäftigen, zugleich wohnlichen Stadt entsprechen. Die wirklichen Verhältnisse zeigen in dieser Richtung keinen Ehrgeiz. Der Umbau der Städte wird demnächst endgültig sein. Wir werden mit Städten, die so ähnlich sind wie die, die wir vor Augen haben, ins 21. Jahrhundert eintreten.«3)
Was Alexander Kluge schreibt und zum Gegenstand seines Films macht – Thema ist die, und dies ist durchaus wörtlich zu verstehen, Unheimlichkeit der Zeit – stimmt und stimmt doch nicht; denn was Kluge fünfzehn Jahre vor der Jahrtausendwende mutmaßte, kann fünfzehn Jahre nach der Jahrtausendwende nicht bestätigt werden: Der Umbau der Städte ist noch immer nicht abgeschlossen. Und ebenso wenig sind es die Illusionen, nach denen die Vorstellungen vom Leben in der Großstadt bestimmt sind, wie sie in den allgemeinen Images von Wohnen, Gemütlichkeit, Design und Einrichtung in Prospekten, Zeitschriften, Kinofilmen und Fernsehsendungen ihren Ausdruck haben und seither als Reklamebilder die städtebaulichen Gestaltung von Häusern, Siedlungen und ganzen Quartieren begleiten: Seit den 1980er Jahren beschränkt sich die Inszenierung des Privatlebens nicht mehr auf das Arrangement des hübsch und behaglich zusammengestellten Mobiliars, das von der Hausfrau im Kittel geputzt und entstaubt wird, damit der Mann einen entspannten Feierabend mit Bier und Sportschau haben kann; die Bilder von der festgefügten Einheit der Knorr-, Maggi-, Rama-Familie sind verschwunden zugunsten von eher chaotisch anmutenden Szenarien von Patchwork-Familien, die sich auf engstem Raum ihren gemeinsamen Lebensabschnitt mit einfachen Wegwerfmöbeln zustellen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche etc. sind offene Räume, weitgehend bereinigt von den alten Insignien väterlicher Autorität und mütterlicher Fürsorge. Und auch die Kinder haben die Grenzen ihrer Zimmer überschritten; die Spielzeugwelten von Lego® und Playmobil® – übrigens so brachial-dumm gegendert wie noch nie – reproduzieren die allgemeine Infantilisierung und Verhübschung nachbürgerlicher Lebensweisen und gehören längst zum integralen Bestand des posturbanen Interieurs. Zwar stellt sich Papi immer noch ein bisschen blöd beim Kochen an, doch im Prinzip können und dürfen alle alles in dem Bereich, für den Miete gezahlt wird oder den man vielleicht sogar als Eigentum erworben hat.
Alexander Mitscherlich hatte vor fünfzig Jahren, also 1965, bereits prognostiziert, dass »die Kunst, zu Hause zu sein« drohe, sich ins Gegenteil zu verkehren: »ins Unvermögen, es zu Hause auszuhalten«;4) um die Wohnkultur ist es nicht besser bestellt als um das, was im allgemeinen Sinne als »whole way of life« als Kultur bezeichnet wird. »Es gibt kein richtiges Leben im falschen« – zu erinnern ist daran, dass Adornos berühmt-berüchtigte Sentenz aufs Wohnen bezogen war: »Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen. Die traditionellen Wohnungen, in denen wir groß geworden sind, haben etwas Unerträgliches angenommen«, heißt es Mitte der 1940er in den ›Minima Moralia‹.5) In einer vorherigen Fassung des Manuskript hatte Adorno geschrieben: »Es lässt sich privat nicht mehr richtig leben.«6) Das ist mitnichten eine Einschränkung des falschen Lebens auf die so genannte Privatsphäre, sondern charakterisiert, ganz im Gegenteil, mit welcher Brutalität dem bürgerlichen Ideal, dass der Mensch sich seine Welt menschlich einrichte, buchstäblich das tragende Gerüst weggebrochen ist. Allerdings: auch wenn das Ich zwar nicht Herr im eigenen Haus ist, so darf es doch in den Mietwohnungs- und Eigenheim-Idyllen wenigstens ein bisschen Ichstärke simulieren: jede in den Werbe-Klischees vom urbanen Leben vorgeführte Situation wird glücklich-lächelnd vollzogen – und je mehr der Handlungskomplex »Wohnen« bloß auf das Dauergrinsen der Leute reduziert wird, desto weniger Architektur, desto weniger umbauter Raum, ja desto weniger Beton ist zu sehen. Die Städte und Bauten, in denen die Menschen hausen, sind nur noch Kulisse, Attrappen der Skylines, nach denen die Städte als Städte identifiziert werden (Fernsehturm, die fünf Hauptkirchen, CCH etc. – das ist Hamburg), nicht mehr konkret (auch im Sinne von »concrete«).
War die Vorstellung vom Leben in der Stadt früher von der Immobilie bestimmt (nach lat. ›im-mobilis‹ = unbeweglich), so gehört zu der eigentlich statischen und fixen Vorstellung urbaner Lebensweisen die Beweglichkeit, Flexibilität, Mobilität (Möbel, nach lat. ›mobilis‹ = beweglich). Der Etui-Mensch, den Walter Benjamin als bürgerlichen Typus im 19. Jahrhundert entdeckte – das bessere Leben wurde mit Stofftapete, Samtdecken und Wolkenstore gleichsam wie Brille und Taschenuhr in ein Etui eingehüllt –, ist ausgestorben. Wie das Wohnen selbst, sind auch die Wände, die es einst – schützend – umschlossen, beweglich geworden, haben sich die Grenzen zwischen Innen- und Außenarchitekturen aufgelöst.
»Wohnen« ist heute weniger eine räumliche Funktion, sondern vielmehr eine individuelle Haltung, die den architektonischen wie sozialen Raum überhaupt erst herstellt: das verlangt ein Individualitätstypus, der sich erst in den 1980er Jahren im Zuge der als postmodern bezeichneten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse herausbildete; ein Individualitätstypus indes, der zunächst noch relativ speziell und disparat konfiguriert war, sich aber vor allem dann seit den Nullern mit den alten, zumal familiären Rollenmodellen verkoppelte und allgemein wurde. Zunächst war dieser Individualitätstypus durch zwei Extreme gekennzeichnet, die sich allerdings in ihren Wohnvorstellungen ähnlich waren, wenn auch mit vollkommen entgegengesetzter sozialer Orientierung: Das eine Extrem ist der Yuppie, der Young Urban Professional, der Anfang der Achtziger die urbane Bühne betrat; das andere Extrem ist der autonome Hausbesetzer.
Yuppie und Hausbesetzer richten sich in den Ruinen ein, wohnen in den Architekturen, die als Leerstand durch Stadtflucht und die innerstädtischen Umbaumaßnahmen übrig geblieben sind: Verlassene Fabriken, unrentabler Altbau. Yuppie und Hausbesetzer bevölkern dieselben Sanierungsgebiete in der so genannten Kernstadt; zwar tun sie das in ihrer sozialen Konfiguration mit allerhand Konflikten, gleichzeitig aber in der Ausgestaltung und der Einübung der individuellen Lebensweise weitgehend in aller Ruhe (nämlich wesentlich abgekoppelt von den mittlerweile nivellierten Lebensweisen, die sich mit der kleinbürgerlichen Angestelltenkultur in den 1970ern manifestierten): Bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts konnte ausprobiert werden, welche Musik man hört, welche Kleidung modisch ist, welche Drogen gut sind und wie man sich einrichtet, um sich so im emphatischen Sinne eine Identität zu gestalten (die sich paradox der Norm widersetzte, dabei aber zugleich normprägend war); anders gesagt: bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts konnte ausprobiert werden, wie überhaupt ein Lifestyledesigntwird.
So sind Lebensentwürfe entstanden, mit denen in den letzten zehn Jahren schließlich klassische bürgerliche Sozialtypen reaktiviert und für die aktuellen Anforderungen optiert werden konnten – die urbanen Nonkonformisten von einst haben einen konformen Urbanismus stabilisiert (einmal davon abgesehen, dass die konservativen wie progressiven Rebellen von früher mehr oder weniger durch die Bank weg alle ihren Weg zurück ins ordinäre, stupide und trostlose Familienleben städtischer Prägung gefunden haben). Was sich daraus für Stadt- und Stadtteilentwicklungen ergeben hat, wird seit einigen Jahren bekanntlich mit dem Schlagwort Gentrifizierung diskutiert (den Begriff hatte die Soziologin Ruth Glass Ende der 1960er bereits mit Blick auf Umstrukturierungen in London verwendet; meistens werden mit Gentrifizierung jedoch erst die urbanen Veränderungen in zum Beispiel Soho, New York, Anfang der 1980er bezeichnet, womit wie wieder bei den Yuppies wären …).
Die Yuppies ergötzten sich am Charme der maroden Altbauten, ließen sich die Fabriketage zur Loftwohnung renovieren. Auch die Architektur für Hausbesetzungen war in der Regel der leerstehende, zudem meist vom Zerfall, gelegentlich auch vom Abriss bedrohte Altbau. Die Häuser der Hafenstraße, ebenso Pinnasberg, Klausstraße, Schröderstift und – bereits seit 1970 kollektiv besetzt – das Wohnhaus in der Haynstraße 1, schließlich aber auch das Gebäude der Rote Flora (und heute noch partiell der Gängeviertel-Komplex) sind dafür mehr als exemplarisch: In den Resten der Architektur des bürgerlichen Zeitalters versuchten junge Leute das Experiment einer antibürgerlichen Lebensweise. Hier gibt es wenigstens den Platz, der in den Blöcken des sozialen Wohnungsbaus fehlt. Entscheidend ist, dass das nicht nur die Architektur einzelner Gebäude betraf, sondern die Neuordnungsmöglichkeit ganzer Straßen und sogar Stadtteile: Noch bis in die 1990er Jahre verfügten St. Pauli, Schanzenviertel, Eimsbüttel und Barmbek immerhin über eine Infrastruktur, die nur angeeignet oder neudeutsch gesagt: neu bespielt werden musste: Mit Kneipen, Cafés, Obst- und Gemüseläden, Boutiquen etc. (Hingegen hatte man in Steilshoop, Mümmelmannsberg, Osdorfer Born, Neuwiedenthal etc. die Infrastruktur schlichtweg stadtplanerisch vergessen oder eingespart.)
Postmodern war dieser Experimentierwille, sich sein Leben selbst zu gestalten und damit »Wohnen« neu zu definieren, insofern, weil er sich explizit von der modernen Architektur distanzierte: Was Alexander Mitscherlich als die ›Unwirtlichkeit unserer Städte‹ bezeichnete, reduzierte sich jetzt auf die Kritik am Beton in jeder Form: »Lieber Instandbesetzen als kaputt Besitzen!« wurde ergänzt von der Parole »Schade, dass Beton nicht brennt!«. Mit der Ablehnung des Betons war ein Bruch mit dem modernen Bauen vollzogen (entschiedener und entscheidender als es die Architektur der Postmoderne selbst machte). Statt zusammengefuschter Neubau, wird der solide Altbau bevorzugt.
Dass es spezifische Formen des urbanen Lebens gibt, wird seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts diskutiert (wegweisend Georg Simmel, ›Die Großstädte und das Geistesleben‹, 1903; auch Louis Wirth, ›Urbanims as a Way of Life‹, 1938). Stahlbeton wird 1867 Patent angemeldet (im selben Jahr veröffentlicht Karl Marx den ersten Band vom ›Kapital‹). Das moderne Leben in den Städten ist von Anfang an mit Beton gestaltet, die funktionelle Stadt, die Le Corbusier in der Charta von Athen 1933 entworfen hat, ist selbstverständlich eine Siedlung aus Beton beziehungsweise, wie es später, ab den 1940er Jahren heißen wird, Béton Brut. Ohnehin ist die Moderne bautechnisch seit Louis Sullivan (»Form follows function«, Wainwright Building in St. Louis von 1891) durch den Beton bestimmt. Überdies galt Beton recht früh schon als leicht zu beschaffendes, günstiges Material, mit dem auch sozialistische Utopie architektonisch verwirklicht werden konnte, und zwar im Großmaßstab: die Bauhaus-Siedlung Törten, Halle-Neustadt, auch Brasilia sind dafür die Beispiele; spätestens seit den 1970ern weiß man allerdings: keine guten Beispiele!
Wenn nun die Esso-Häuser oder vor ein paar Jahren das Frappant-Gebäude politisch verteidigt werden, kann es nicht ernsthaft um die Qualität dieser Architektur gehen; wohlwollend wäre der Kampf für den Erhalt der Gebäude als Aktualisierungsversuch der alten Planungsmacht sozialistisch konzipierter Architektur zu interpretieren (dafür fehlt es allerdings insgesamt an urbanen bzw. posturbanen konkreten Utopien …). Tatsächlich geht es banal erst einmal um nicht mehr als die Verteidigung gewohnter und bewährter – wenn auch nicht gelungener, geschweige denn glücklicher – Lebenszusammenhänge im Stadtteil: auch aus dem falschen Leben will man sich nicht vertreiben lassen. Und immerhin ist der Beton, für den hier gestritten wird, ja mittlerweile längst Altbau und kann als historische Architektur des Stadtteils repräsentationspolitisch in ein kollektives »Wir« integriert werden.
Bautechnisch und raumgestalterisch hat man dem Beton eigentlich nichts entgegenzusetzen. Die genossenschaftlichen Wohnprojekte, die seit Ende der 1990er in Hamburg errichtet wurden, sind allesamt Neubauten in Betonbauweise, selbstverständlich klimaneutral und energiesparend, und das heißt vor allem: hässlich, einfallslos, mit Dämmplatten aus Styropor und Rauputz verkleidete »Komfortgreuel, die unsere technischen Mittel hervorzubringen erlauben«.7) Nahtlos fügen sie sich in architektonische Langeweile ein, die mehr und mehr das Stadtbild bestimmt. Dann doch lieber zurück zum Beton.
(Zuerst in: taz.am wochenende‹, Ausgabe Nord, 4./5. Juli 2015.)
- Alexander Kluge, ›Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Das Drehbuch zum Film‹, Frankfurt am Main 1985, S. 8. (↑)
- Kluge, ›Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit‹, a. a. O., S. 10. (↑)
- Kluge, ›Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit‹, a. a. O., S. 10. (↑)
- Alexander Mitscherlich, ›Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden‹, Frankfurt am Main 1965, S. 10. (↑)
- Theodor W. Adorno, ›Minima Moralia‹, GS Bd. 4, S. 43. (↑)
- Vgl. Theodor W. Adorno Archiv, Ts 2208; ermittelt hat das: Martin Mittelmeier, ›Es gibt kein richtiges Sich-Ausstrecken in der falschen Badewanne‹, in: ›Recherche – Zeitung für Wissenschaft‹, 31. Januar 2010. – http://www.recherche-online.net/theodor-adorno.html (↑)
- Mitscherlich, ›Die Unwirtlichkeit unserer Städte‹, a. a. O., S. 11. (↑)
(180)