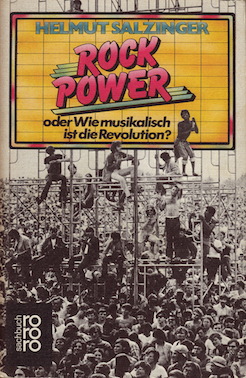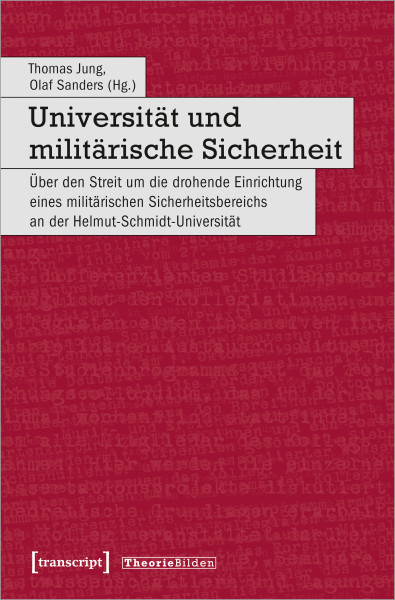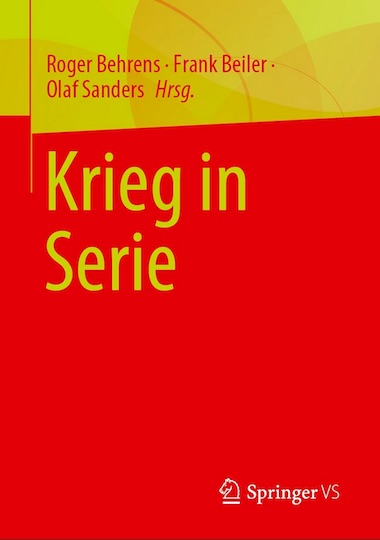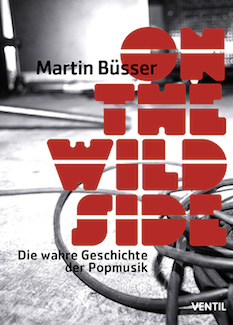
Von der wilden Seite der Geschichte
»Jimi Hendrix ist unmittelbar mit den 68ern verbunden, Punk mit den sozialen Umständen im Großbritannien der ausgehenden Siebziger. Die Zeitumstände machen Musik nicht nur spannend, sondern überhaupt erst verständlich. In der heutigen, von Zitaten nur so durchdrungenen Popmusik gilt deshalb mehr denn je: Wer die Musik verstehen will, muss auch ihre Vergangenheit kennen.« Martin Büsser, ›On the Wild …

Wie sollen wir das Kapital lesen?
Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey und Jacques Rancière, ›Das Kapital lesen‹, hg. von Frieder Otto Wolf unter Mitwirkung von Alexis Petrioli, übersetzt von Frieder Otto Wolf und Eva Pfaffenberger, Verlag Westfälisches Dampfboot: Münster 2018, 764 S. brosch., 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. (127)
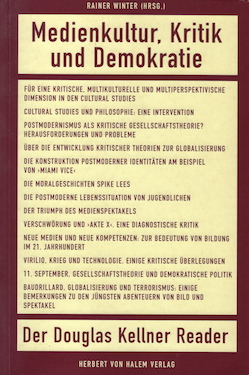
Medienkritik als demokratische Kultur
Rainer Winter (Hg.), ›Medienkultur, Kritik und Demokratie. Der Douglas Kellner Reader‹, Herbert von Halem Verlag: Köln 2005, 382 S. brosch. (80)

Schöne Ghettowelt
Rassismus, Antisemitismus, Ressentiments definieren eine politische Normalität, die nicht länger auf Konzepte der Agitation und Aufklärung vertrauen lässt. Was Anfang der Neunziger schon als gescheitertes Programm der allerletzten K-Gruppen feststand und mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus unterging, hat sich in den vergangenen zehn Jahren auch als kulturelles Modell erledigt: In der neuen Mitte hat sich das Dumpfe eingerichtet, ein Sozialcharakter, der seine psychohistorische Parallele hat: ›Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches‹. Unter der Oberfläche sozialistischer, auch antifaschistischer Politik war bereits 1932 ein autoritärer wie ohnmächtiger Konformismus zu verzeichnen. Von »zynischer Sachlichkeit« spricht Marcuse später in seinen ›Feindanalysen‹ über Nazideutschland. Als Triebstruktur hat sich dieses System länsgt wieder etabliert, die ›Diktatur der Angepassten‹ nannten es Blumfeld auf dem Album ›Testament der Angst‹.

Freibaduniversität
September 2016
Vorankündigung: Kulturrevolution und Gesellschaftskritik (II).
Hinweis: In Erinnerung an Martin Büsser widmet sich die Freibaduniversität jedes Jahr im September historischen und aktuellen Aspekten der Popkultur als soziales Verhältnis.
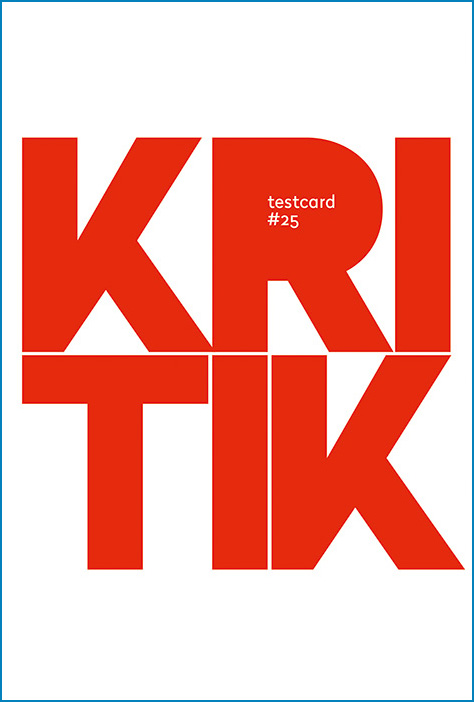
Kritik
Vor zwanzig Jahren, im September 1995, erschien die erste Ausgabe des Buchmagazins ›testcard. Beiträge zur Popgeschichte‹. Thema: »Pop & Destruktion«, damals noch im Testcard Verlag Oppenheim. Testcard heißt Testbild. Wikipedia informiert: »Testbilder dienen zur Beurteilung der Bildqualität von Fernsehapparaten und Monitoren sowie zur Unterstützung bei Bildeinstellung und Fehlersuche … Bis Ende der 1980er Jahre wurden die Testbilder einige …
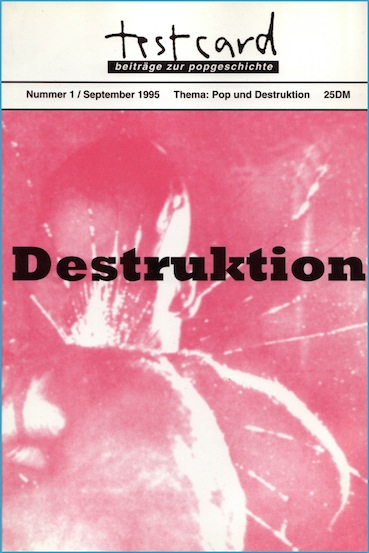
Pop & Destruktion
»Wie die Aufnahme der inzwischen so gut wie ausverkauften Nr. 1: ›Pop und Destruktion‹ gezeigt hat, scheint es uns – bei allen Anfangsschwierigkeiten – gelungen zu sein, mit ›testcard‹ ein Diskussionsforum zu schaffen, auf dem Popthemen abseits auch von lähmenden dogmatischen Beschränkungen diskutiert werden können.« – Die Selbsteinschätzung mit kleinem Eigenlob der ›testcard‹-Redaktion ist voll und ganz begründet: …