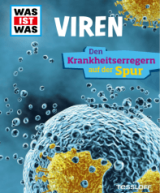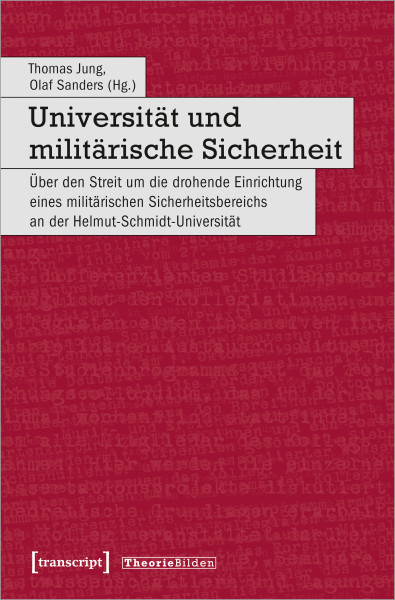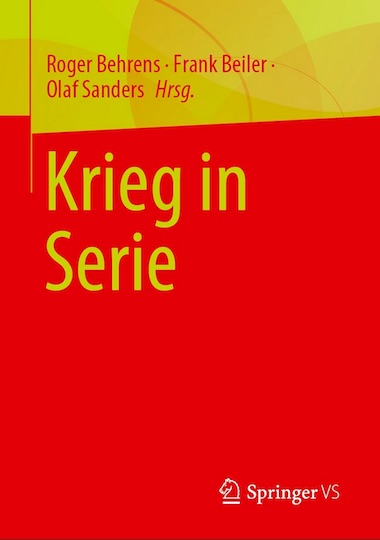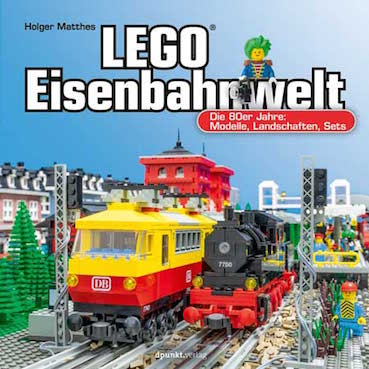
Graue Klemmbaustein-Ära – Die achtziger Jahre
Holger Matthes, ›LEGO®-Eisenbahnwelt. Die 80er-Jahre: Modelle, Landschaften, Sets‹, dpunkt.verlag: Heidelberg 2022, 264 S. brosch. Von der Verlagsseite: »Du hast in den 80er-Jahren mit einer LEGO-Eisenbahn gespielt? In diesem Buch wirst du deinem Set von damals wiederbegegnen! Holger Matthes, Autor von »LEGO-Eisenbahn« und bei AFOL (Adults Friends of LEGO) bekannter Experte zum Thema, beschreibt alle LEGO-Eisenbahn-Sets dieser Zeit und …
Zur Bildung von Spielzeug-Welten
Zur Bildung von Spielzeug-Welten (Kolonialisierung der Kindheit) 1. Bildung wird seit Humboldt begriffen als Selbst- und Weltaneignung; der Idealismus systematisierte das in seiner Hochphase, nämlich der Philosophie Hegels, als Phänomenologie des Geistes: Selbst- und Weltaneignung gehen als Bildungsprozess zusammen, das Selbstbewusstsein ist Weltwissen. Bei Hegel ist dieser Prozess schon ganz auf Arbeit eingestellt; Schiller hatte das ein paar …

Eine Pädagogik der Hoffnung
»Hoffnung« bestimmte Paolo Freire noch 1996, wenige Monate vor seinem Tod, »als Grundcharakter der Erziehung«; begriffen ist das »im Prozess der Entstehung menschlicher Existenz«, in der »existenziellen Erfahrung«, in der sich der Mensch als »soziales Wesen« erkennt, »das sich seines Seins in der Welt bewusst wird, womit es in eine Präsenz in der Welt übergeht«.
Was bei Freire existenziell, ja existenzialistisch gedacht ist, ergänzt Bloch dialektisch mit einer docta spes, nämlich einer begriffen-gelehrten Hoffnung, einer Hoffnung also, die sich pädagogisch an dem berichtigt, was objektiv-real möglich ist. Wie das umgesetzt werden kann, hat bekanntlich Freire in seiner ›Pädagogik der Unterdrückten‹ als, mit und in Aktionsforschung ausgeführt.
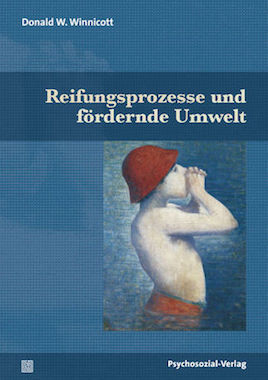
Reifungsprozesse
Donald W. Winnicott, ›Reifungsprozesse und fördernde Umwelt‹, aus dem Englischen von Gudrun Theusner-Stampa, mit einem Vorwort von M. Masud R. Khan, Psychosozial-Verlag: Gießen 2020 (3. Aufl.), 378 S. brosch. Von der Verlagsseite: »Donald W. Winnicott erkannte als einer der ersten Psychoanalytiker die Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Beziehung für die psychische Entwicklung des Kindes. In den hier versammelten Abhandlungen aus …

Individuum und gesellschaftliche Entwicklung
Donald W. Winnicott, ›Der Anfang ist unsere Heimat. Essays zur gesellschaftlichen Entwicklung des Individuums‹, mit einem Vorwort von Claire Winnicott, Ray Shepherd und Madeleine Davis, aus dem Englischen von Irmela Köstlin, Psychosozial-Verlag: Gießen 2019, 304 S. brosch. Von der Verlagsseite: »Die psychoanalytischen Arbeiten von Donald W. Winnicott beeinflussen die Psychoanalyse und ihre verschiedenen Schulen nachhaltig. Seine Erkenntnisse erfuhren …

Erziehung nach Auschwitz
Katharina Rhein, ›Erziehung nach Auschwitz in der Migrationsgesellschaft. Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus als Herausforderungen für die Pädagogik‹, Beltz Juventa: Weinheim & Basel 2019, 359 S. brosch. (115)
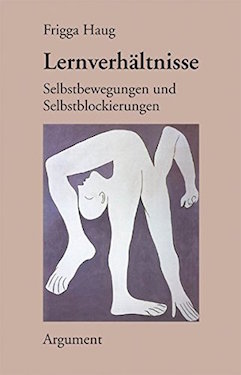
Lernverhältnisse
Frigga Haug, ›Lernverhältnisse. Selbstbewegungen und Selbstblockierungen‹, Argument Verlag: Hamburg 2003, 301 S. kart. Dies ist das vergriffene Buch von 2003. Im März 2020 erscheint als überarbeitete und erweiterte Neuausgabe DIE UNRUHE DES LERNENS. (54)