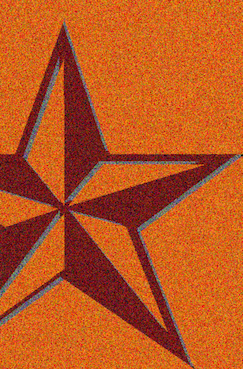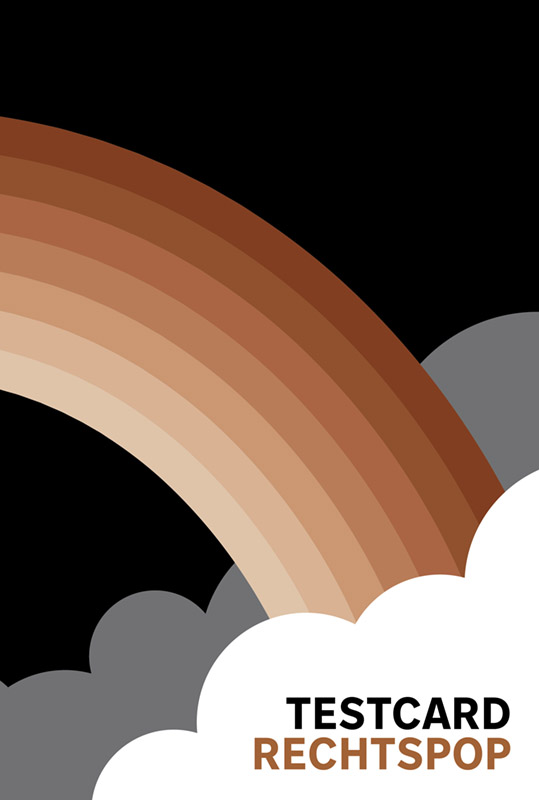Die Schallplattenhülle: Formen von Abbild und Warenfetisch im imaginären Konzertsaal
Den jüngeren Erfindungen ist erst im Zuge ihrer ökonomischen Verwertbarkeit ein ästhetischer Mehrwert hinzugetreten. Der Einsatz moderner Werkstoffe — vor allem Kunststoff — nahm von den technischen Geräten die Spur der Gebrauchsschönheit: an Kameras oder dem Automobil ist es leicht nachzuvollziehen, welcher Unterschied zwischen den alten Materialien und dem neuen Spritzgußplastik steckt. Die Verhübschungen der eigentlich häßlichen Technik stehen in einem proportionalen Verhältnis zu ihrem Kultwert. Das Beiwerk, das Ornamentale tritt als Wesen hervor und läßt das technische Innenleben verschwinden. Ein merkwürdiges Geheimnis, was diesen Gegenständen anlastet: An einem Grammophon ist leichter nachzuvollziehen, welche physikalischen Gesetze hier für die Tonerzeugung verantwortlich sind, wie überhaupt der Ton von dem Lauf der Nadel in der Rille über den Schalltrichter sich verstärkt, als zu verstehen, wie der Laserstrahl digitale Informationen abtastet, die durch Schaltkreise irgendwie in Membranschwingungen der Lautsprecher umgewandelt werden — und doch scheint uns die im Chassis verschlossene Elektronik der Hi-Fi-Bausteine viel vertraulicher zu sein als die freiliegende und offene Technik des Grammophons. Dieses Geheimnis und seine vermeintliche Umkehrung ist nicht bloß aus dem Technischen abzuleiten; vielmehr steht es im Bezug zur Warenform der Gegenstände, benennt ihren Fetischcharakter, die Phantasmagorie. So kann es sein, daß aus einfachen Verpackungen oder Schutzumhüllungen ästhetische Objekte werden, ja daß diesen Objekten die Symbolisierung des Gebrauchswerts ganz überantwortet wird. Wolfgang Fritz Haug sprach vom ‹Gebrauchswertversprechen‹ der Verpackung und deren ‹Ausdrucksabstraktion‹. Das gilt zumal für Verpackungen, ohne die der verpackte Gegenstand scheinbar etwas verliert. Ein Buch ohne Umschlag ist keines mehr; selbst das Fehlen des Schutzumschlags um den Leineneinband verringert den Wert, wenn es auch am Lesestoff nichts ändert. Mit dem Buch hat die Schallplatte hier einiges gemeinsam. Ja, was den Aufwand des Coverdesigns und der grafischen Präsentation angeht, überragt die Schallplatte sowohl das Buch wie auch Luxusgüter — man denke an Parfümflakons — bei weitem. Helmut Salzinger wies in betreff der Schallplatte darauf hin, ‹daß die Verpackung [hier] bereits selber Inhalt geworden ist. Das Album ist nicht bloß die Platte, sondern die Platte in einem ästhetischen-funktionalen Kontext, der das ganze Ding, das Album, zur eigentlichen Ware macht.‹
Die Schallplatte ist Sammlergegenstand mit Kultwert; um die Geheimschrift des Tonträgers zu entschlüsseln, braucht es Abspielgeräte. Die Hülle (und der Labelaufkleber) verraten den Inhalt, machen ihn aber nicht hörbar, auch wenn grafisch alles daran gesetzt wird, dem musikalischen Inhalt durch die Verpackung, die Hülle, ein entsprechendes Bild zu geben. Wie sehr brüsten sich DJs damit, nur anhand der Rillenzeichnung die Platten zu identifizieren, weshalb dann Label entfernt werden; die Hülle ist bei Technoplatten gerne informationslos, blank — niemand soll erfahren, was hier gesampelt wird. Verklärt wird dies als Rückkehr zu funktionalistischem Design. Die Spaltung, die durch die Technoszene geht, spiegelt sich auch in der Covergestaltung: während Vertreter des ‹intelligent techno‹ auf funktionale Klarheit schwören, bemüht die Kirmestechnofraktion sämtliche Filtereffekte der Grafiksoftware, fraktale Geometrie und nach Weltraum oder Drogen anmutende Typografie. Obwohl beide Lager einig in dem Aufwand sind, der der Ver- und Umhüllung des Tonträgers gewidmet wird; denn gleich, welches Argument bemüht wird, sei es auch noch so funktionsorientiert: dem je schon vorhandenem Geheimnis des musikalischen Codes auf dem Tonträger tritt ein weiteres Geheimnis in Form der Hüllengestaltung hinzu. Die Informationen, die auf der Schallplattenhülle gegeben werden, reichen nie an den musikalischen Gehalt heran. Und doch hat sich im Verlauf der einhundertjährigen Geschichte der Schallplatte eine Bilderschrift kristallisiert, nach der bisweilen auf den Inhalt der Musik genauer geschlossen werden kann als dies etwa durch eine Partitur möglich wäre. Diese Bilderschrift übersteigt die Verpackungs- und Schutzfunktion der Tonträgerhülle — sie ist mit den Begriffen der Reklame, der Werbung der Musik für sich selbst, der Warenästhetik zu deklinieren. Ihr kommt eine Eigenständigkeit zu, die allen technischen Angeboten an den Plattensammler zuwiderläuft, sich von den Covers zu trennen: von den in den 20er Jahren aufgekommenen ‹Alben‹ über die Stapelautomatik der Plattenspieler bis zum 500-CDs-aufnehmenden CD-Spieler hat sich nichts dergleichen durchsetzen können. Statt dessen finden sich spezielle ›Phonomöbel‹, die immer wieder zum Präsentieren der beschaulichen Sammlung an Tonträgern animieren. Dabei gehört auch die Schallplatte zu jenen Dingen, die erst später durch eine ästhetische Hülle attraktiv gemacht wurden. Die Ware wird, wie Walter Benjamin sagt, ‹auf sentimentale Art vermenschlicht‹, ihr wird ein ‹Haus‹ gegeben. Plattencover sind ungleichzeitige Rudimente der Etuis, Überzüge und Futterale, mit denen der bürgerliche Hausrat im 19. Jahrhundert überzogen wurde.
Die ersten Hüllen für Schallplatten wurden 1910 eingeführt: ein einfacher Papierumschlag, zum Teil mit einem Loch in der Mitte — die Informationen zur Schallplatte finden sich auf dem Labelaufkleber. Ein Jahr später, 1911, folgen bedruckte Papiere: typisch sind um diese Zeit Rahmenornamente, die ein wenig an die Gestaltung von Notenbüchern erinnern; verstärkt findet sich nun Werbung auf der Hülle, etwa für Schallplattennadeln. Seit den 20er Jahren wird über die Namen der Bands, der Interpreten, der Komponisten und der Songs informiert, oft im bildlichen Verbund mit charakteristischen Szenen, beispielsweise tanzende Jugendliche. Die Jazzmusik wird — um die Schallplatten auch in den rassistischen Südstaaten verkaufen zu können — weitgehendst nur grafisch verpackt, ohne Abbildungen der Musiker; bis in die 60er Jahre ist es bei Rock-’n’-Roll-Platten nicht selten, statt der schwarzen Musiker Weiße abzubilden. Michael Ochs gibt in seinem Kompendium von tausend ausgesuchten Schallplattencovers einige Beispiele: 1958 wird eine Hülle der Chantels (‹We Are The Chantels‹, End 1958), die die fünf schwarzen Sängerinnen zeigt, ersetzt durch ein Cover ersetzt, das ein weißes Pärchen vor einer Musikbox zeigt; eine Platte der Crests (‹The Best Of The Crests‹, Co-Ed 1961) zeigt als einzigen Musiker Johnny Mastro, der auch der einzige Weiße in der Band war.
Seit 1939 gibt es Bildhüllen mit meist grellfarbigen Zeichnungen; sie sind der Ausgangspunkt für die sich entwickelnden Stereotypen der Covergestaltung, die mit den 50er Jahren sich bilden und vorrangig auf die neue Käuferschicht der Jugend abzielen. Neben der rassistischen Umgestaltung von Hüllen werden die ersten Schallplatten verboten: nicht aufgrund der Musik, sondern aufgrund der Covergestaltung. Die meisten Verbote gab es wegen sexueller Anstößigkeit, bis hin zur Groteske. Auf einem Cover der Five Keys (‹The Five Keys On Stage‹, Capitol 1957) posieren die fünf Musiker in einer Reihe von rechts nach links; ein Daumen des links die Reihe abschließenden Sängers ist derart an der Hose gehalten, daß er als Penis mißdeutet werden kann — der Daumen wurde retuschiert. Üblich waren auch Verbote von vermeintlich aggressiven Coverabbildungen, so zum Beispiel ein Presley-Album (‹Elvis Presley‹, RCA Victor 1956), das ihn mit schreiendem Gesichtsausdruck wild die Gitarre spielend zeigt — links steht in Rosa ‹Elvis‹, unten in Grün ‹Presley‹, das Foto ist schwarzweiß; The Clash griff mit ‹London Calling‹ (Epic 1979) auf dieselben Gestaltungselemente zurück — solche Adaptationen und Zitationen in der Covergestaltung sprechen für einen vermehrten ästhetischen Anspruch, der zum Teil auf den größeren Einfluß der Bands auf die Gestaltung zurückgeht. Zunehmend besorgen auch Künstler die Gestaltung, wobei zu den bekanntesten nach wie vor Andy Warhol (Velvet Underground: same, Verve 1967; Rolling Stones, ‹Sticky Fingers‹, Rolling Stones 1971), Peter Blake (Beatles, ‹Sgt. Pepper’s‹, Capitol 1967), H. R. Giger (Emerson, Lake & Palmer, ‹Brain Salad Surgery‹, Manticore 1973) oder Mike Kelley (Sonic Youth: ‹Dirty‹, David Geffen Comp. 1992) zählen. Künstler wie Roger Dean (Yes, Gentle Giant, Babe Rush etc.) oder Hipgnosis (etwa: Pink Floyd: ‹Wish You Were Here‹, Columbia 1975; Led Zeppelin, ‹Houses Of The Holy‹, Atlantic 1973) machten sich durch Covergestaltung einen Namen. Das Cover soll während des Musikhörens betrachtet, ja wie eine Partitur gelesen werden. Dafür steht nicht nur die eigens entwickelte, oft auch mit dem Stand der Produktivkräfte brechende Bilderwelt — man denke an die verwunschenen, archaischen Landschaften eines Roger Dean —, sondern auch die zunehmende textliche Information auf den Hüllen. Vor allem Plattenhüllen aus dem Bereich der Kunstmusik geben ausführliche Informationen über das Orchester, das Werk oder den Komponisten; so wird dem Käufer beigebogen, etwas Bildungsgut gekauft zu haben, ein Produkt ernster Musik, zu der auch Halbwissen zum Verständnis gehört. Während in der Popmusik gemeinhin zur Werbung der Abdruck der Hittitel auf dem Cover reichte (‹Including the Smashhit …‹), versuchten einige Rockbands nicht nur musikalisch ins Lager der klassischen Kunstmusik zu wechseln. Das Paradebeispiel dürfte Jon Lords ‹Concerto for Group and Orchestra‹ (Deep Purple und The Royal Philharmonic Orchestra, EMI 1969) sein, ein Cover ganz im Stil einer Klassikplattenhülle: die Schrift ist sachlich-schlicht, informiert über den Komponisten, den Ort der Aufführung und zeigt den Ort auch, den Konzertraum der Royal Albert Hall, wo inmitten der gediegenen Atmosphäre die Musiker von Deep Purple sitzen. Auf der Rückseite belehrt ein Text über den ästhetischen Gehalt der einzelnen Instrumente und der Komposition; die Rockmusiker sind in der Manier von Orchestervirtuosen fotografiert.
Ebenso wird durch visuelle Effekte und grafische Besonderheiten versucht, dem Cover einen speziellen ästhetisch-konsumistischen Reiz zu verleihen: Das kann der eingeklebte Reißverschluß auf dem ‹Sticky Fingers‹-Cover ebenso sein wie besondere Materialien, Metall, Textilien oder Holz. Die Verbesserung von Drucktechnik tut das ihre dazu, ebenso die psychodelische Musik. Es entstehen aufwendige, hohe Produktionskosten verschlingende Plattenhüllen. Zum imaginären Konzertsaal der Konservenmusik kam das imaginäre Museum des Covers hinzu. Längst hat das Cover seine reine Schutzfunktion aufgegeben; auch über den bloßen Reklamezweck will es hinausweisen. Es erscheinen regelrechte Bilderbücher, passend zu einer erzählend angelegten Musik (The Who: ‹Tommy‹, Decca 1969, und: ‹Quadrophenia‹, Polydor 1973; Rick Wakemans ‹Journey To The Centre Of The Earth‹, Ariola 1974). Erst die Punkmusik gibt dem politischen Protest auf dem Cover einen breiten Raum; sie knüpft gleichzeitig an Coververeinfachungen des Politrocks an, benutzt gefaltete, unifarben bedruckte Papierhüllen, die zum Poster ausgebreitet werden können (Cover von Crass). Gerade diese Musik, die sich gegen den Bombastrock wehrte, greift auf die Hülle mit zusätzlich eingehefteten Informationen zurück (Cover von Dead Kennedys). In den 80er und schließlich 90er Jahren werden die Stereotypen ausgedünnt: Zunehmend gibt der leicht verhüllte oder nackte, sich sexuell anbietende Körper der Frau das Hauptmotiv ab. Die Musik gibt zudem vor, in einen Legitimations- und Selbstverortungsprozeß zwischen Kulturindustrie und künstlerischer Autonomie getreten zu sein und möchte von hier aus ebenso die Rolle der Musiker neu bestimmen; die Differenz zwischen Produzent und Rezipient wird nivelliert: eine aufwendige Covergestaltung, die den Anschein des ästhetischen Werts versprach, verschwindet zugunsten einer grafischen Inszenierung des Alltags: Autos, Straßenleben, Familie oder Bilder aus der Plattenproduktion finden zunehmend Verwendung (The Cranberries, ‹No Need To Argue‹, Island 1994; Oasis, ‹Definitely Maybe‹, Creation 1994). Andererseits wird der ästhetische Aufwand technischen Möglichkeiten überlassen: Mit entsprechender Hard- und Software leicht zu reproduzierende Computeranimation ersetzt das grafische Handwerk (Björk, ‹Post‹, One Little Indian 1995).
Ein Gemeinplatz scheint der Hinweis auf die Warenform der Musik zu sein; oft ist damit aber nicht mehr gemeint als bloß, daß die Musik zunächst über den Tauschvorgang angeeignet werden muß. Und das gelingt freilich nur in ihrer Greifbarkeit — als Tonträger —, weshalb sich die musikalische Warenanalyse dann auch meist auf die ökonomistische Formel ‹Die Warenform der Musik ist die Schallplatte‹ (Simon Frith) beschränkt. Ähnlich betonte jüngst Christoph Gurk: ‹Im Hinblick auf die Musikindustrie nimmt Kultur die Warenform an erster Stelle durch den Tonträger an.‹ Ausgespart bleiben Überlegungen, die einzig Sinn machen, kritisch von der Warenform zu sprechen, will man nicht bloß den Tauschvorgang namhaft machen: es ginge um den Widerspruch von Gebrauchswert und Tauschwert. Warenförmigkeit der Musik steckt im Tonmaterial; von dort aus greift die Warenform auf Äußeres über, etwa die Verpackung. So wirkt nach Haug ‹Warenästhetik als Scheinlösung des Widerspruchs von Gebrauchswert und Tauschwert.‹ — Wäre der Tonträger an sich die Warenform, bräuchte es nicht die designte Hülle. ‹Die gegenständliche Umwelt des Menschen nimmt immer rücksichtsloser den Ausdruck der Ware an. Gleichzeitig geht die Reklame daran, den Warencharakter der Dinge zu überblenden … Die Ware sucht sich selbst ins Gesicht zu sehen.‹ Kaum ein Massenprodukt erfährt soviel Design wie das Cover; die Reklamefunktion, selbst schon ästhetische Zutat zur Schutzfunktion der Hülle, kehrt in der mannigfaltigen Bilderwelt des Covers als Emblem wieder (hinsichtlich der Bandnamens-Emblematik buchstäblich). Man hat dem Schallplattencoverformat gegenüber dem CD-Format ein besonderes Maß zugesprochen; auch das Vinyl hat Nostalgisches. Wer heute sagt ‹Das ist unser Lied‹, der muß die Scheibe dazu haben, ganz gleich, wieviel Kratzer drauf sind. Die Schallplatte bewahrt eine Spur der Vergangenheit; ihre Verpackung, die auch nur Reklame ist, versteckt den ästhetischen Mehrwert der Emblematik. ‹Die Embleme kommen als Waren wieder.‹
Literaturhinweise
S. Thorgerson und R. Dean, Das Buch der Schallplattenhülle, Zürich 1980f. (mehrere Bände); H.-J. Feurich, Warengeschichte und Rockmusik, in: W. Sandner (Hg.), Rockmusik. Aspekte zur Geschichte, Ästhetik, Produktion, Mainz 1977; Technostyle, The Album Cover Art, Collins & Brown: London 1996, und das im Aufsatz erwähnte Buch von M. Ochs, 1000 Record Covers, Taschen-Verlag: Köln, London et al. 1996, 850 S., 1000 Abb., 39,95 DM.
Roger Behrens
[Erschienen in: Jazzthetik, 1997]
(280)