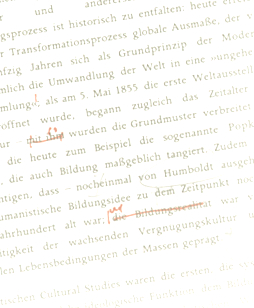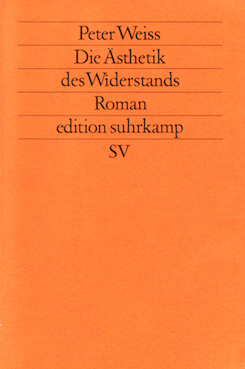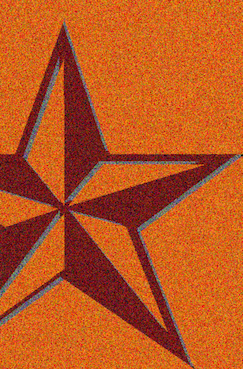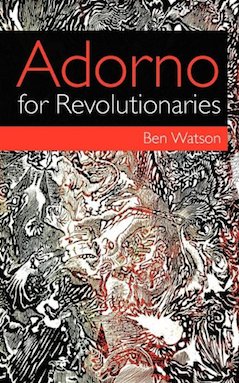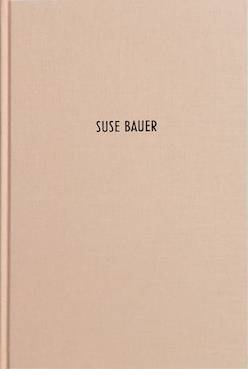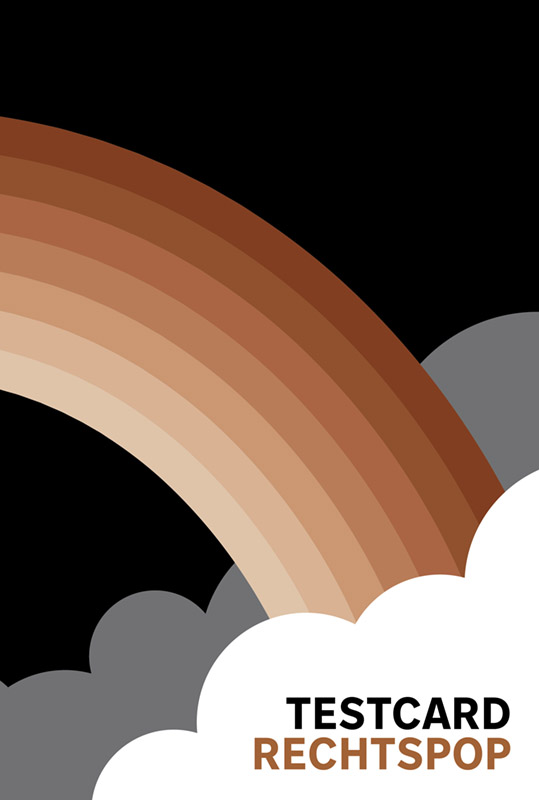Drei Anmerkungen zur Poplinken – Maxiversion
Vorbemerkung (I): In der HH19 ist nicht nur eine gekürzte Version des eigentlich gemeinten Beitrags erschienen; der beschränkte Platz hat auch die ursprüngliche Absicht, den Topos der Kultur- oder Poplinken mehrfach auf seine geschichtlichen Bedingungen hin zu reflektieren, auf die gerade so problematische Selbstreferenzialität der Poplinken reduziert. Die Poplinke ist das fortgeschrittene Stadium der Kulturlinken; sie verweist auf die Geschichte, auf die die Kulturlinke mittlerweile zurückblicken kann. ›Eine eigene Geschichte / Aus reiner Gegenwart / sammelt und stapelt sich …‹ Diese Geschichte lebt allerdings von Selbstbezug und -bezeugung, ist ›Kulturgeschichte‹ – mithin maßgeblich der Reflex auf die Strukturveränderungen der Massenkultur und des durch sie vermeintlich bedingten Wandels des Sozialen. Will sagen: die Kulturlinke thematisiert zwar die Gegenwärtigkeit einer Kulturindustrie, blendet jedoch die Dialektik der Aufklärung, die dieses Jahrhundert bezeichnet, aus. Das Soziale und Politische erlebt sie gefiltert durch die Kultur: die abstrakten Mechanismen der Repression werden als solche der Alltagskultur wahrgenommen, aus dem Blickwinkel der Nische in der Popkultur; die konkrete Gewalt – etwa in Form des Krieges – wird Thema der Kritik, wenn sie als Phänomen des Pop kritisiert werden kann, wo der Krieg bereits als Popereignis erscheint. Durchaus ist die Poplinke sensibel für die historische Gewalt, die auf diesem Jahrhundert lastet; das Verhältnis, welches die Poplinke zu ihr gewinnt, ist aber eines von ›Interesse‹ – nur wo solche Gewalt unmittelbar in den Erfahrungshorizont der Gegenwart hineinreicht, wird sie zur Kenntnis genommen. Für eine Gegenwartsdiagnose mögen die Konzepte von Normierungsmacht und Kontrollgesellschaft nutzbar sein; um Auschwitz zu denken, fehlt ihnen die Reichweite. So verblasst Vergangenheit zum Geschichtszeichen. Gegen Adornos Diktum aus der ›Negativen Dialektik‹, wonach alle Kultur nach Auschwitz Müll sei, samt der Kritik an ihr, erweist sich Popkultur insgesamt als immun – sie gilt, gleich ob Mainstream oder Subkultur, als Nachkriegserscheinung, postfaschistisch. Dabei steckt in Adornos Satz der Verdacht, der nicht krude abzuschlagen ist: Pop hat seine Urgeschichte im 19. Jahrhundert (wie der Spätkapitalismus überhaupt); die soziale Funktion der Kultur als Kitt entfaltete der Nationalsozialismus ebenso gekonnt wie die Massendemokratie. Dass Pop die reine Kultur ist, die Adorno als Müll bezeichnete, berührt Reflexionsebenen, die in der Poplinken nicht vorgesehen sind. Überhaupt ist in der Kulturlinken der Begriff ›Kultur‹ so fragwürdig wie jener der ›Linken‹. Er ist nämlich zunächst ein bürgerlicher, abgezogen vom Verständnis der ›affirmativen Kultur‹, die sich als Reich des schönen Scheins gegen die harte soziale Wirklichkeit setzt. Nur dass im Pop dieser Schein noch heller strahlt, weit in den Alltag hinein. An der Popkultur interessiert offenbar ihre identifikatorische Kraft, nicht die negatorische Seite der Kultur. Auch deshalb kann die Kulturlinke weitgehend aussparen, dass bereits bei den Frühsozialisten die Kulturfrage selbstverständlich für die emanzipatorische Bewegung als konstitutiv galt (der Rekurs auf Robespierre und den ›Wohlfahrtsausschuss‹ Anfang der Neunziger erscheint bisweilen selbst nur als popistisches Kokettieren mit dem geschichtlichen Problembezug). Es hat spärliche Versuche gegeben, Gramscis Kulturtheorie poplinks zu wenden; einige berühren psychoanalytische Kulturtheorien, dann von Lacan inspiriert; heute steht Bourdieu und seine Soziologie der symbolischen Formen hoch im Kurs. Was aber eine linke Kulturpraxis einschließen müsste, nämlich eine utopische Dimension der Kultur, negativ wie prospektiv, und das heißt die praktische Entfaltung einer Kultur der Verweigerung als Aufhebung der Kultur, – das fehlt. Vielmehr besteht zwischen Kultur und Links-Sein so etwas wie eine enharmonische Verwechslung, wird das eine im anderen abgebildet, identifiziert, also gleichgemacht, trotz aller postmodernistischen Rede von der Differenz.
Vorbemerkung (II): ›Ein Werk, das die richtige Tendenz aufweist, braucht keine weitere Qualität aufzuweisen. Man kann auch diskretieren: ein Werk, das die richtige Tendenz aufweist, muss notwendig jede sonstige Qualität aufweisen.‹ Letztere Position sagt: Der bloß politische Popsong reicht mitnichten. Der Autor dieses Zitats meinte beileibe keine Popmusik, sondern politische Dichtung; Walter Benjamin griff mit diesen Sätzen eine zentrale Figur der damaligen kulturpolitischen Debatte auf, kristallisert im Begriff der Tendenz – heute könnte man Parteinahme sagen. Es ging um Form, Inhalt und die dialektische Vermittlung von beiden; es ging um Fortschritt in der Kunst und eine Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Kultur; es ging um die Formulierung einer neuen Kultur und die Reflexion auf die soziale Stellung der Künstler, eine Kritik der kulturellen Produktionsbedingungen und -verhältnisse. – Die ursprüngliche Überschrift des Beitrags sollte nach einem Satz von Benjamin lauten: ›Poplinks hatte noch alles sich zu enträtseln – Der Hedonismus und die Avantgarde.‹ Benjamin hatte 1930 folgendes allegorische ›Denkbild‹ entworfen: ›Die linken Vögel behielten gegen den Grund des erstorbenen Himmels etwas von ihrer Helle, blitzten mit jeder Wendung auf und unter, vertrugen oder mieden sich und schienen nicht aufzuhören, eine ununterbrochene, unabsehbare Folge von Zeichen, ein ganzes, unsäglich veränderliches, flüchtiges Schwingengeflecht – ein lesbares – vor mich hinzuweben. Nur dass ich abglitt, um mich stets von neuem bei den andern zurückzufinden. Hier stand mir nichts bevor, nichts sprach zu mir … Links hatte noch alles sich zu enträtseln, und mein Geschick hing an jedem Wink …‹ Das stand zunächst als Motto da, ebenso wie die Zeilen aus Blumfelds ›So lebe ich‹: ›… Ein freier Markt bewegt die Welt / besetzt die Nischen / … / regiert die Nacht / verteilt das Geld / Ein Widerstand mit andern Mitteln / … / Im Showgeschäft Gefühle zeigen / Ein Protestsong von Geisterhand …‹ Und Schlagzeuger Andre Rattay sagt: ›Links ist da, wo die Hi-Hat steht.‹
1. Die besseren Partys
›Hier also, in dem Reiche des ästhetischen Scheins, wird das Ideal der Gleichheit erfüllt, welches der Schwärmer so gern auch im Wesen nach realisiert sehen möchte.‹ Friedrich Schiller, ›Über die ästhetische Erziehung des Menschen …‹
Was unter dem Vorzeichen, dass es keine Linke mehr gäbe, ›links‹ zu Beginn des nächsten Jahrhunderts bedeuten könnte, erzwingt die Frage nach der Zerfallsgeschichte der Linken im 20. Jahrhundert. Was die Linke im 20. Jahrhundert erreicht – oder besser nicht erreicht – hat, verlangt mehr als die geübte Selbstkritik an politischen Strategiefehlern. Dass die Revolution nicht stattfand, lag nicht an der mangelnden Mobilisierung oder an den falschen Parolen. Dass die Revolution nicht stattfand, lag vor allem – freilich von der Übermacht des Feindes, den es zu besiegen galt, abgesehen – an einer Linken, die Nationalismus, Rassismus, Antisemistismus und Sexismus in den eigenen Reihen zuließ. Kurzum, obwohl das 20. Jahrhundert, angefangen mit dem sozialistischen Großexperiment der Oktoberrevolution, im Zeichen der Linken – und das heißt Humanisierung – der Welt zu stehen scheint, zeigt sich im Rückblick, wie sehr oft genug die Linke ihr Gegenteil war.
Damit ist übrigens besonders die deutsche Linke hervorgetreten, bis hin zu maßgeblichen Wortführern der 68er, die sich mittlerweile als Neue Rechte bekennen, nebst Zusatz, nie etwas anderes gemeint zu haben. – Die sogenannte Pop- oder Kulturlinke glaubte als politischen Fehler der Linken die Politik selbst zu erkennen und meinte die Politik zugunsten der Popkultur verwerfen zu können. Schon als Konzept einer immanenten Kritik der Linken ist das fraglich; derart allerdings doch wieder politische Kritik an der Rechten zu deklarieren, verkommt dies Konzept zur Tragödie (die Punkbewegung bis zur APPD) oder zur Farce (Schlingensiefs Versuch, mit Horst Mahler das bürgerliche Theater zu dekonstruieren). Darüber hinaus liegt der Kulturlinken der doppelt merkwürdige Befund zugrunde, wonach die traditionelle Linke keine adäquate Auseinandersetzung mit dem ›kulturellen Feld‹ kannte, und die Politik sich dort einholen ließe, wo die Politik des Sozialen sich in Kultur auflöst – wenn alles Pop wird, dann ist poplinks auch politisch; und wenn Pop das Gemisch aus Party, Musik und Sex ist, dann proklamiert poplinks die besseren Parties, die bessere Musik, den besseren Sex. Diejenigen – wie etwa Diedrich Diederichsen –, die das als Konsens der Linken definiert haben wollten, nivellierten die Linke damit als Konkurrenzunternehmen zur Rechten, im Sinne des Attraktivität, des Indentifikationsangebots für Jugendbewegungen. So betreibt man Jugendzentren, aber keine emanzipatorische Praxis.
Die Ablehnung der Politik zielte vor allem gegen die Lustfeindlichkeit der K-Gruppen und der Autonomen. Statt das Private zum Politischen zu machen, sollte die Politik privat werden: mit Hilfe postmoderner Versatzstücke schrieb sich die Kulturlinke fast unbemerkt die modernsten Ziele auf ihre Fahnen: das autonome bürgerliche Individuum. In der Wahrnehmung der Gesellschaft als vorrangig kulturelle, popistische Großveranstaltung reicht der subversive Widerstand des Individuums gegen die ›Kontrollgesellschaft‹ (Gilles Deleuze), wie Mark Terkessidis und Tom Holert es vertreten, allerdings tatsächlich nicht weiter als zur Beurteilung, ob man gerade auf der besseren Party ist oder nicht. Die Partykultur wird jedoch nicht zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift; ihr fehlt die Solidarität, die sich nicht durch eine neue Freundlichkeit ersetzen lässt, wie Diederichsen es in der ›Beute‹ vorschlug (Neue Folge, Heft 1, S. 37 ff.). Freundlichkeit macht den Konkurrenzdruck der Individuen erträglicher, bleibt aber die moralische Schuld der eigenen Generation. Dagegen verlangt Solidarität, nach einem Satz Benjamins, den – übrigens unmoralischen – Kampf für das Recht der vergangenen Generationen. Das meint, eine Position zu entwickeln, die sich darüber bewusst ist, dass auch die besseren Parties nach wie vor im ›Zeitalter des Exterminismus‹ (Edward P. Thompson) statt finden.
2. Die bessere Musik
Eine Frau wird verhaftet, weil sie Slimes ›Deutschland muß sterben‹ öffentlich abspielt, während Atari Teenage Riot ihre Hardcoretechno-Coverversion desselben Stückes im Musikfernsehen präsentieren. Die Kulturindustrie verwandelt sich in Reklame für die Welt, so wie sie ist. Als Verwaltungsapparat der Warengesellschaft ist ihre schärfste Waffe die Integration: wo Subversion und Protest nicht selbst bereits lancierte Produkte sind, wird Widerstand zu Werbestrategien, zu Accessoires der jeweils neuesten Moden. Die repressive Toleranz (Herbert Marcuse) macht Ideale und Mode synonym, solange die Ideale eine Frage der Form bleiben. Der poplinke Standpunkt des besseren Geschmacks verteidigt die Ideale als Formfrage, auch indem überhaupt das Problem des Widerspruchs von Form und Inhalt ausgespart wird – die Kulturlinke ist damit nicht nur nicht gesellschaftskritisch, sondern streng genommen nicht einmal kulturkritisch. In den Neunzigern gelang es zwar, Ansprüche auf die Massenkultur durchzusetzen, und mit HipHop, House, Drum ’n’ Bass und Techno wurde den Verhältnissen ihre eigene Melodie vorgespielt – die kulturelle Hegemonie wurde jedoch nicht durchbrochen, sondern verschoben: Der ›Club der kulturell Verunsicherten‹ in der Roten Flora taugt als poplinke Veranstaltung so viel und so wenig wie dieselbe Veranstaltung, die jetzt unter dem Namen ›Klub K&N‹ firmiert.
Die Reflexion auf den Inhalt ist eine historische. Die Kulturlinke operierte bloß kulturell historisch, indem sie die musikalischen Formen der Kulturindustrie vergangener Jahrzehnte nutzbar machte: Disco und den Pop der Achtziger; sie versagte als Linke, wo sie die musikalischen Inhalte vergangener Jahrzehnte als unmodern-unmodisch (›unsexy‹) ablehnte oder delegierte: Die Frauen in der Musikgeschichte sind ein Spezialgebiet für Feministinnen, die experimentelle Musik um R.I.O. (›Rock in Opposition‹) etwas für Jazzfreunde, die Neue Musik etwas für Musikexperten. Die Erbaulichkeit der Popmusik, die die Kulturlinke entdeckte, bemißt sich an der ganz und gar zeitgemäßen Frage, was wieder geht. Der Kulturindustrie in Sachen Trendforschung unter die Arme zu greifen, bestimmt aber keine linke Position. Statt dessen ginge es um die radikale Negation, um die Frage, was nicht mehr geht. In diesem Sinne verlangen die glücklichen Momente ein Sich-Abarbeiten, nicht die simple Affirmation des hedonistischen Genießens: Cpt. Kirk &, Brüllen, TGV, Knarf Rellöm Ism, Die Patinnen, Die Goldenen Zitronen, Die Braut … und dergleichen – als wenn über diese Musik das Verdikt verhängt wurde, dass sie links ist, weil auch links draufsteht, wird die Diskussion ausgespart, die sie doch gerade provoziert. Nicht dass es nicht solche Diskussionen im kleinen Zirkel gibt: gerade die Genannten sind als Theoretiker ihrer eigenen Praxis am Werk (dies zumindest ab und zu in der Kneipe). Theorie durchbricht allerdings selten die Repräsentationslogik, reflektiert nach Außen nur symbolisch den Distinktionsgewinn. Aus der Repräsentationslogik des diskursiven Spiels ist durchaus eine Waffe zu machen; Knarf Rellöm etwa insistiert auf ›Punk als Haltung‹ und operiert musikalisch an der Front: Der operative Umgang mit dem Material erinnert an Tretjakow, die Musik ist gleichsam ›episches Theater‹, präsentiert den ›offenen Bühnenraum‹, also Freilegung der Produktionsbedingungen, als wenn es um die Übersetzung Brechtscher Ideen vom Gestischen ginge: und bei Knarf Rellöm Ism Unterhaltung funktioniert nur politisch (wenn sie auch streitbar bleibt, so wie Alexander Diehl einwarf, dass ›Hey Everybody‹ auf ›Fehler ist King‹ mit der Zeile ›Das war kein Sozialismus / Das war Spießerkram …‹ den politischen Song durchs Gimmick zu depotenzieren droht).
Gemeint ist die Diskussion über die alte Frage, was Kunst wie und wann politisch macht. Diese Frage ist eine des Materials wie des Gehalts; die Kulturlinke hat inmitten ihrer Postmodernisierungsstreitereien zwischen Köln, Berlin und Hamburg entschieden, allein schon die Frage als ›platten Materialismus‹ zu diffamieren, um statt dessen das Problem als Repräsentationskritik popdiskursiv abzuschieben. Doch zwischen der politischen und der künstlerischen Avantgarde ist die Vermittlung nicht ein diskursives Problem, sondern mindestens eines der politischen und ästhetischen Praxis. Isabelle Graw, Christoph Gurk, Andreas Fanizadeh und andere haben die Elaborate und das Programm der Gruppe ›Kunst und Kampf‹, die Bernd Langer in seinem Buch ›Kunst als Widerstand‹ vorgestellt, zu Recht als künstlerische wie politische Unzumutbarkeiten abgelehnt, die zwischen reaktionärem Kunstverständnis und Männerphantasien schwanken. Das Gegenkonzept gegen die falsche Unmittelbarkeit, bei der der Kapitalist noch das Schwein mit Zylinder ist, reicht jedoch nicht weiter als zur Verteidigung der Abstraktion. So gleichen sich schließlich die diametralen Positionen in der Naivität, mit der einmal eine offenbar unbegriffene Frage nach dem Zusammenhang von Kunst und Politik beantwortet sein will, und mit der sie auf der Gegenseite mit der Ästhetik des Abstrakten als unbeantwortbar annulliert wird. Solche Naivität ist nicht ungefährlich, wenn die falsche Unmittelbarkeit auf die begrenzte Abstraktionsästhetik trifft – man kann sich über den heimlichen ›Die Kunst dem Volke‹-Stalinismus von Bernd Langer und der Göttinger Antifa/M. beschweren, oder die Selbstverliebtheit der linken Ästheten um ›Texte zur Kunst‹ belächeln; dass Politik in Kunst dann doch transformierbar ist, lässt man sich derweil von Euthanasie-Befürworter und DJ Chris Korda begeistert vorführen (›Zu guter Letzt ist der Kampf gegen die Menschheit auch der Kampf gegen den Kapitalismus,‹ schreibt Ted Gaier in einem Artikel über Chris Korda, der für die ›Testcard 8‹ vorgesehen ist – solche kalkulierte Dummheit ist zu diskutieren, und dann kann ja noch immer gefragt werden: ›Was ist romantisch für Ted Gaier?‹).
Noch ein Versuch: ›Das dominierende ästhetische Programm der radikalen Linken kennt kein Patagonien, die Bowlingbahn nur als verleugnetes oder heimliches Vergnügen.‹ Das, so Fanizadeh weiter in seinem Beitrag (›Beute‹, Neue Folge, Heft 1, S. 122 f.), zeige sich etwa an der Gruppe ›Kunst und Kampf‹ um Bernd Langer. Zu einem eventuell ›produktiven Missverständnis‹ sei es gekommen, als die Gruppe zum Soli-Abend ›die Hamburger Kamerun-Band [einlud], deren heterogener, ironischer und brüchiger Stil das genaue Gegenprogramm zur eigenen Homogenisierungstaktik ist‹ (S. 125). Gleichwohl kann eben das auch bezweifelt werden: Es ist zu vermuten, dass etwa in der unsensiblen, unmusikalischen Perspektive von Kunst als Widerstand, die Erklärung der Welt in Stereotypen dann musikalisch genau so funktioniert, wie ihnen die Goldenen Zitronen klingen. Was Fanizadeh als den heterogenen, ironischen und brüchigen Stil der Goldenen Zitronen ausmacht, ist ja eben nicht einer Ästehtik des Materials geschuldet, sondern des ›anvisierten Kontextes‹ (Isabelle Graw). Kontextualisierung vermag aber höchstens, die eigene Haltung zur Kunst – zur Popkultur – zu objektivieren; damit lässt sich freilich leicht urteilen, die Goldenen Zitronen seien ästhetisch brüchiger als ›Kunst und Kampf‹ – aber um das festzustellen, braucht man eigentlich nur den krudesten Kunstbegriff, um zu merken, dass hier sowieso jenseits aller Kategorien und Reflexion von Kunst die Rede ist. Interessanter ist da doch Kameruns neuestes (Solo)-Projekt, seine ungefähr zehn-minütige Trashtechnoshow unter dem Namen Sylvesterboy, mit Boxershort, Römerhelm, US-Flagge als Cape, Plastikschwert. Während beim 1999-S.O.S.-(Struggle of Students)-Konzert in der Fabrik mit EinsZwo und Blumfeld Sylvesterboy allgemein und im Besonderen (›Free Mumia!‹) auf Zustimmung stieß, begegnete das Publikum beim (ersten) Tocotronic-Konzert im Docks Kameruns Showeinlage mit Unverständnis, mit Pfiffen und Bierbecherwürfen Richtung Bühne. Freilich sind solche Reaktionen kalkuliert oder provoziert, gehören zum Spiel der Kontextualisierung. Als gemeinte Selbstironisierung ist das unproblematisch, gerade weil das Politische different gehalten wird – wenn es um politisch ernsthafte Strategien von Empowerment oder Dekonstruktion geht, etwa in offensiv feministischer Musik, geraten Versuche materialästhetischer Bestimmungen fast zwangsläufig zur bodenlosen Überinterpretation. Den Zusammenhang von Kunst und sozialem Kontext immer wieder neu zu bestimmen, bleibt als rein deskriptives Unterfangen bedeutungslos; kulturlinks wäre aus solchen Erfahrungen die Kultur (respektive Kunst) beständig neu zu bestimmen …
3. Der bessere Sex
… und das will meinen: Wo der Linken die Kultur wichtig ist, fragt sie nach deren Funktion, nach der Stellung der Kulturproduzenten; sie versteht dies als operativen Eingriff gegen die bestehenden Verhältnisse und für diejenigen, die sich dagegen wehren. Kontextualisierung heißt in dieser Hinsicht, die Konstellation von Kunst (Kunstwerk wie -konzept; Material), Produzent und Rezeption (Publikum, Konsum, Genuss) als fortwährenden Prozess der Diskussion zu begründen – als Selbstverortung. Der Subjektivismus der Kulturlinken kennt diese Selbstverortung scheinbar nur als monologisches Prinzip zwischen Produkt und Produzent; das Publikum ist in die Beobachtungsposition zurückaffirmiert worden – auch wenn diese oder jene Band dem Publikum nicht schmeckt, wird weiterhin weiterhin eine Art Publikumslinke supponiert. Doch zu den Mobilisierungskonzerten von Blumfeld, Tocotronic, Superpunk, TGV etc. für die Demonstrationen gegen den Bergedorfer Naziaufmarsch 1999 sind die meisten wohl gekommen, um schlicht die Musik zu hören. Freilich sind ein Dreitausenderpublikum zu solchem Zweck für ein antifaschistisches Öffentlichkeitsbild besser als nur die spärliche Sechshunderterdemonstration; dennoch stehen hier Probleme an, die mit dem Konzept der Kulturlinken unmittelbar zu tun haben. Die Kulturlinke kennt nämlich keine Bewegung; ihr Adressat ist ein Publikum, welches zunächst offenbar genauso konsumiert wie das verschmähte Mainstreampublikum; auch poplinks verlangt man Unterhaltung und nicht Rechenschaft über Produktionsbedingungen. Man möchte Spaß, und fast scheint es, als seien es Minderheiten, die sich wenigstens darüber freuen, wenn ihnen der Spaß von Linken verabreicht wird. Das führt, in einem kleinen Umweg, den aber die Poplinke selbst ausgeschildert hat, nun zum dritten Postulat vom besseren Sex. Die Kulturlinke versprach, dass die Warengesellschaft nur lustvoll abgeschafft werden kann; geeinigt hat man sich wohl darauf, dass diese Gesellschaft nicht abgeschafft zu werden braucht, solange sie ein bisschen ›Sexiness‹ zulässt.
Es wird behauptet – nicht nur von Poplinken, sondern auch von liberal gesinnten Anwälten der populären Künste –, in den (post-) modernen Formen der Massenkultur schaffe sich ein neuer, lustvoller Körper Raum; gegen die körperfeindliche Gesellschaft, die das Begehren und die Lüste aussperre, habe sich jenseits des Mainstream Orte und Inseln der subversiven Körperpraxis gebildet: das alte Programm der künstlerischen Avantgarde, die die Grenze zwischen Leben und Kunst aufheben wollte, realisiere sich nicht in der ästhetischen Rationalität der bürgerlichen Kunst, sondern in einer ästhetischen Befreiung ›reiner Praxis‹, die keine ›Theorie‹ (also keine ›Schau‹, keine ›Reflexion‹, keinen ›Geist‹) brauche.
Die Idee der Befreiung, die die Kulturlinke an den Körper bindet, macht den Sex, die Erotik, die Lust selbst, zum Fassadenphänomen, zum Accessoire der jeweiligen Mode. ›Sexiness‹, als poplinke Leitfigur nicht umsonst von heterosexuellen Männern als Kampfbegriff in den Diskurs eingeführt, hat nur insofern mit Foucault (auf den man sich in dieser Hinsicht beruft) zu tun, als dass über Sex nicht gesprochen wird: man zeigt seinen Sex, stellt sich zur Schau, repräsentiert den sexualisierten Körper. Die lustvolle Politik, die sich in den sexualisierten Körpern entäußert, ist bemerkenswerter Weise gegenüber der Sexualität, ihrer Repression, ihrer Tabus, ihrer Perversionen und Gewalt, neutral, naïv. Die Realität von Homophobie und Sexismus innerhalb der Popkultur, aber auch die übliche Verklemmtheit, die Angst, die sexuellen Mythen werden von den Bühnen der sexualisierten Popkörper verdrängt; gleichwohl kann ›das Sexuelle‹ ein Zeichen auf der Inszenierungsfläche der Körper sein, solange die Rollenverteilung klar bleibt (nur wer als Lesbe erkennbar ist, darf sich als Lesbe zu erkennen geben; sein perverses Begehrens darf zeigen, wer als ›pervers‹ erkennbar ist, zum Beispiel als schwul; die Künstlerin erlaubt sich Libertinage und die Hetenbeziehung die Zwangsmoral.
An ihren äußerten Punkten widerfährt den Körpern doch noch der theoretische Zugriff: die Rede ist von der Dekonstruktion der Geschlechter. Vorerst scheint das ein theoretisches Projekt zu bleiben, jedenfalls ist schwer vorstellbar, dass sich die Auflösung der Geschlechter anders als bloß spielerisch gegen die Verhärtungen der Körper durchzusetzen vermag. Vielleicht ist die Geschlechterdekonstruktion die krudeste Deckung der herrschenden Ideologie; vielleicht ist sie aber auch die einzige Praxis, an der eine radikale Poplinke sich entfalten könnte.
Es geht nicht um die Verteidigung eines ›wahren‹ oder ›echten‹ Sexes, eigentlich nicht einmal um die Verteidigung der Erotik (ein Wort, womit man sich im sexy Popdiskurses schnell mal lächerlich machen kann). Wer mich kennt, weiß dass ich am wenigsten geeignet bin, über solche Fragen mich zu äußern; diese Anmerkung zum ›besseren Sex‹ soll eher eine doppelte Verwunderung ausdrücken: Weshalb im Namen des Sexes eine sexualisierte Kultur im Sinne einer entsinnlichten Politik unterstützt wird; weshalb ›Sexiness‹ also ausgerechnet dort sein soll, wo am wenigstens Schweiß, Gestank, Zärtlichkeit, Ficken ist? Und: Weshalb überhaupt im Namen des Sexes eine linke Kultur proklamiert wird, wo doch – folgt man Freud – entweder der Sex als die Sexualität nur die verdrängte Form der Lust ist, oder aber als Lust selbst von eben der Kultur zur Versagung gewungen wird? Es scheint, als sollte das Lustprinzip befreit werden, ohne das Realitätsprinzip überhaupt in Frage zu stellen. So wie die Linke mit der Kultur von der Politik befreit werden sollte, ohne die Gesellschaft in Frage zu stellen.
Nachbemerkung (I): Links bleibt der kategorische Imperativ, den Marx in der Einleitung ›Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie‹ formulierte: ›… alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.‹ Dies ist die Haltung, die die Kulturlinke als moralische Position vereiteln will; sie ist aber nur wirksam wie glaubhaft als Haltung, sofern sie auf der kritischen Theorie der gesellschaftlichen Praxis sich gründet. Marcuse hat in den sechziger Jahren von den zwei sich entgegenstehenden Hypothesen gesprochen: 1. die bestehende Gesellschaft verhindert ihre qualitative Änderung; 2. dennoch sind Kräfte vorhanden, die dies durchbrechen und ›die Gesellschaft sprengen‹ könnten. Man mag darüber diskutieren, ob diese Hypothesen auch heute noch begründet sind (und ich meine: ja, erst recht heute); sie markieren jedoch die gegenwärtigen Defizite der (Kultur-) Linken: stand bisher die Linke selbstverständlich auf der Seite der verändernden Kräfte, so hat sich unter dem Vorzeichen der Kulturlinken ein radikaler Wandel vollzogen; mit ihren Programmen ist die Kulturlinke in die Defensive gerutscht und hat sich zum Teil sogar zur Fürsprecherin der bestehenden Verhältnisse gemacht. Man muss die kritische Theorie nicht neu erfinden, um den kategorischen Imperativ von Marx zu begründen; es braucht allerdings eine gewisse Beharrlichkeit im Grundsatz des Kommunismus, dass diese Welt nicht die beste aller möglichen ist –.
Roger Behrens
[Dieser Text erschien in einer gekürzten Version 2000 in der HH19 (mittlerweile eingestellt)]
(160)