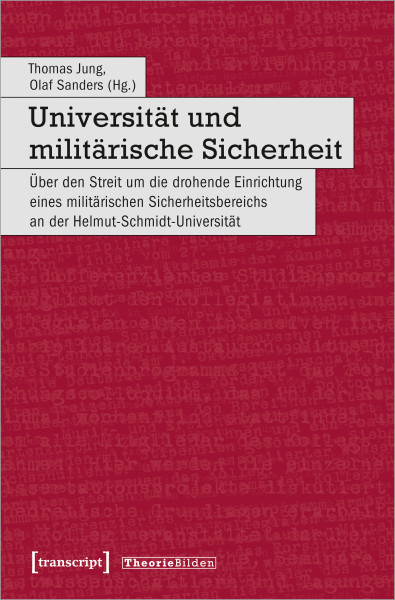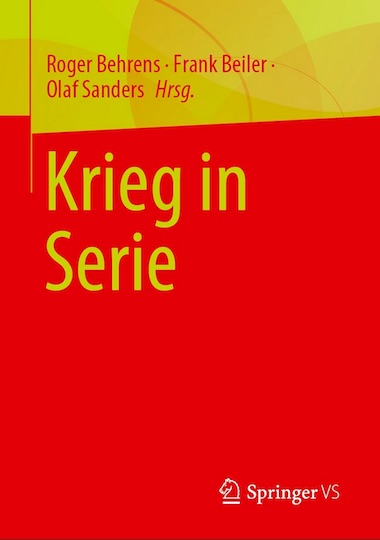Quais são seus principais interesses?
Quais são seus principais interesses teóricos e práticos atuais?
Uma entrevista com sinal de menos.

Die Jazzmaschine spielt Samba
Der Philosoph Eduardo Silva über die doppelte Kulturindustrie Brasiliens und die Unterschiede zur deutschen Popgesellschaft
Form und Inhalt sind zu unterscheiden: Formal ist Brasilien zum Beispiel von der Kulturindustrie der USA abhängig, aber inhaltlich zeigt sich eine eigenständige, wenn auch heterogene Kultur. Zunächst hat Brasilien, durch seine besondere Kolonialgeschichte, keine klassische bürgerliche Hochkultur, sondern eine traditionelle plurale Kultur – die sich aus europäischen, indianischen und afrikanischen Einflüssen zusammensetzt. Diese im Alltagsleben verankerte Kultur hat mittlerweile auch eine Industrie, weshalb von einer doppelten Kulturindustrie in Brasilien gesprochen werden kann: Eine industrielle westliche Mainstream-Kultur und der Versuch, das Traditionelle Brasiliens ökonomisch zu kulturindustriell geschehen ist, in Brasilien mit Chorinho oder Samba, der Musik aus den Armenvierteln, passierte. Deshalb, so meine ich, ergibt sich von Brasiliens Massenkultur aus ein anderer Blick auf die Kulturindustriethese der Kritischen Theorie.

Gespräch mit Claus-Steffen Mahnkopf
In der neuen, endlich erschienenen Ausgabe der ›Zeitschrift für kritische Theorie‹ (zu Klampen Verlag) findet sich ein Gespräch mit dem Komponisten und Philosophen Claus-Steffen Mahnkopf. Regensburger Runde:Ein älteres Gespräch, an dem Mahnkopf und ich beteiligt waren, findet sich in einer gekürzten Printversion hier beziehungsweise als Video hier. (73)

Die Ästhetisierung der Politik
Walter Benjamin verließ am 17. März 1933 das nationalsozialistische Deutschland und ging ins Exil. 1936 erschien in französischer Übersetzung Benjamins Aufsatz ›Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit‹ in der ›Zeitschrift für Sozialforschung‹. Benjamin schrieb die erste Fassung seines umfangreichen Essays von September bis Dezember 1935; die zweite Fassung, die Benjamin als »Original« bezeichnete, lag im Februar 1936 vor – auf ihr basierte die Übersetzung von Pierre Klossowski, beide Fassungen entstanden in Paris. Bis zum Frühjahr 1939 arbeitete Benjamin noch an einer dritten Fassung. Auf der Flucht vor den Nazis stirbt Benjamin am 26. September 1940 in der spanischen Grenzstadt Port Bou.