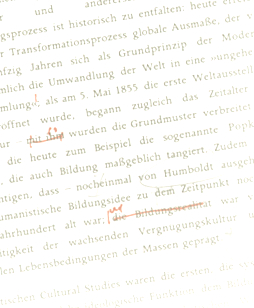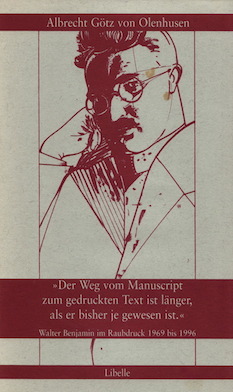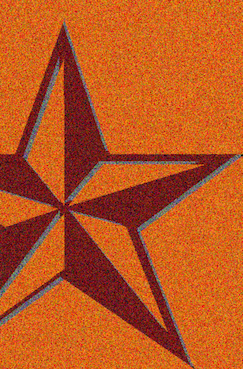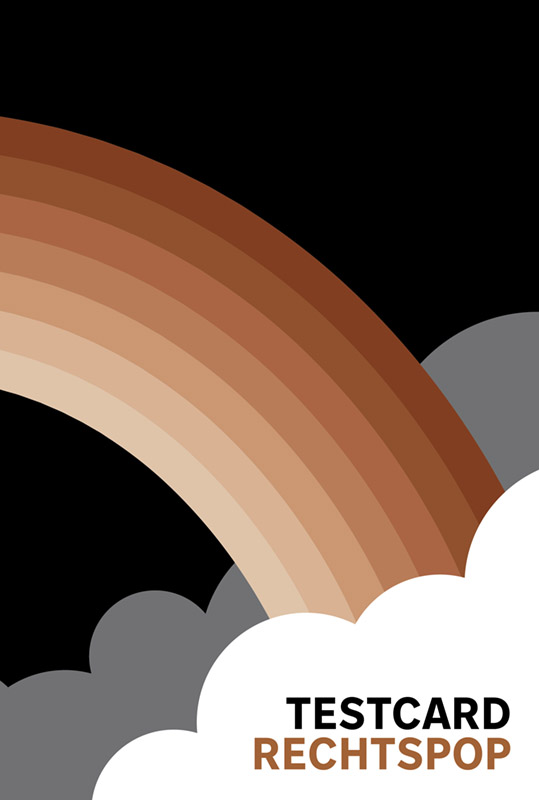Was ist das Digitale?
Was bedeutet »digital«? Zurück zum Barock: Das Adjektiv »digital« wird in den 1650er Jahren erstmals im physiologisch-anatomischen Sinne mit der Bedeutung »in Bezug auf Finger oder Zehen« verwendet und ist dem Lateinischen ›digitus‹ = Finger, Zehe entlehnt (verwandt mit Lat. ›dicere‹ = »zeigen«). Gebildet wurde das Adjektiv aus dem Substantiv ›digit‹, das bereits nachweislich im späten 14. Jahrhundert verwendet wird: Gemeint sind damit die an den Fingern abzählbaren Zahlen von 1 bis 10. In der explizit technischen Bedeutung (»apparative Verwendung numerischer ›Digits‹«) wird das Adjektiv »digital« erstmals 1938 verwendet und setzt sich dann nach 1945 mit der Entwicklung der Computertechnologie als allgemeiner Terminus für jedwede maschinelle, später elektrische, schließlich elektronische Kalkulationen durch.
Das Digitale ist auch eine allgemeine Bezeichnung für die informationstechnologische Verrechnung der Welt, sinnkontextualisiert mit »Kommunikationen« sowie weitgehend synonym mit »Computer«.
Die Zuschreibung, etwas sei »digital« oder »digitalisiert«, bleibt alltagssprachlich ungenau und vage. Die rein technische bzw. physikalische Bedeutung des Wortes hat sich seit den achtziger Jahren gleichermaßen ins Kulturelle wie Sozialökonomische verschoben.
Dabei wird das »Digitale« metaphorisch vollkommen überdehnt, der Sinngehalt von »digital« verwässert und überzeichnet, schließlich das digitale Gerät, der Computer, mystifiziert und magisch überhöht (»Digitale Religion«). Das Digitale an sich wird mit der gesellschaftlichen Totalität verwechselt. Ob das Wahre nun das Ganze oder das Ganze das Unwahre ist, erscheint gleichgültig, alles ist »digital«, es reicht ein loser Bezug zur Computer- und Informationstechnologie; das Akzidentielle des rein technischen Verfahrens wird zum Essentiellen: seit den 1990ern wird unter dem Vorzeichen des Digitalen alles, was auch nur irgendwie im Zusammenhang mit Elektronik steht, neovitalistisch in bloßer Assoziationsverkettung als »digital« verbrämt: »Magazin für das Leben mit elektronischer Musik, mit Computern, ihren Fähigkeiten, und somit den elektronischen Lebensaspekten« (Untertitel ›De:Bug‹). Das geht soweit, dass Ende der neunziger Jahre und dann in den Nullern selbst die Rede vom Postdigitalen noch vom digitalen Geschwätz absorbiert wird. Diese Bedeutungsüberhöhung bleibt allerdings nicht auf kulturhypertrophe Nischendiskurse beschränkt (Fantum, Fachzeitschriften, Fachidiotismus Steckenpferde, Expertentum, akademisches Spezialwissen, Cultural Studies zum Teil, Medientheorie insgesamt etc.), sondern bildet einen Slang, der durch die totale Durchdringung des Alltags mit (digitalen) Medientechnologien zum allgemeinen – und überdies durchaus dann technizistisch restringierten, nämlich banalen, phantasielosen und weitgehend sinnfreien – Sprachcode mutiert (was Christian Demand in seiner Streitschrift ›Die Beschämung der Philister‹ 2003 über den Jargon der offiziellen Kunstkritik herausgestellt hat, gilt für den Techno/Elektro/Musik-Jargon im Speziellen, und offenbart sich als universelles Neusprech im Gehalt bzw. Nichtgehalt jeder irgendwie durchs Digitale gefilterten und vermittelten so genannten Kommunikation, vgl. Youtube-Kommentare, Web 2.0, Facebook, Twitter etc.). Die Californian Ideology geriert sich mittlerweile als ubiquitäres digitales Sozialprogramm.
Alltagssprachlich spiegelt sich in diesem Jargon eine rhetorische Strategie, die ursprünglich zum Kulturpessimismus bzw. Kulturkonservatismus gehörte; betraf das zunächst abstrakte Großkonzepte wie »Untergang«, »Katastrophe« und überhaupt einen Historizismus der »Kultur« wie auch eine Kulturalisierung des Historischen (Einteilung der Menschheitsgeschichte in »Epochen« nach relativ willkürlichen und äußeren Maßstaben), kommen mit fortschreitender Dialektik der Moderne schließlich spätestens in den 1920er Jahren – die goldenen Zwanziger – auch sozial- und kultur-technizistische Großvokabeln in Mode, was sich in der Rede vom Maschinenzeitalter ebenso wiederspiegelt wie in den inflationär verwendeten Schlagworten, die durch die frühen feuilletonistischen Kunstdiskurse verbreitet werden (die »-Ismen«, Neue Sachlichkeit, das Neue Bauen, Funktionalismus; das Etikett »modern« wird zur Floskel etc.). Zu tun hat das mit den frühen, noch bürgerlichen Verabsolutierungen des Kulturellen (Kultur als Wert an sich; vgl. hierzu im Übrigen {a.} die Passage ›Kaiserpanorama‹ in Walter Benjamins ›Einbahnstraße‹, {b.} Max Horkheimers Einlassung auf den Begriff der Kultur in ›Autorität und Familie‹ 1936, aber auch {c.} Edmund Husserl, ›Die Krisis der europäischen Wissenschaften‹ von 1935; freilich auch {d.}, grundsätzlich und immer wieder: Adorno & Horkheimer, ›Dialektik der Aufklärung‹, 1944/47, sowie schließlich {e.} Adorno, ›Kulturkritik und Gesellschaft‹, 1949/1955 …)
Unter dem Vorzeichen des Digitalen und in euphorischer Be- und Entgeisterung über die »elektronischen Lebensaspekte« hat sich der Kulturpessimismus von einst in einen Kulturoptimismus verwandelt; dem Geist nach konservativ ist das Kulturgezwitscher indes geblieben: hervorgegangen aus den Popdiskursen der neunziger Jahre, wird nun vor allem im postbürgerlichen Feuilleton ein liberaldemokratischer Kulturkampf mit allen digitalen Mitteln geführt; dass es dabei mitunter auch gegen die Kultur, gegen das Digitale, gegen die digitale Kultur gehen kann, gehört zum Programm und ist medientheoretisch abgesichert. (Zu zeigen wäre, dass das durchaus etwas typisches Deutsches hat, nicht nur wegen der beharrlichen Bezüge auf Heidegger und seine Rede vom »Gestell« und »Geviert«, sondern ohnehin in der Inszenierung deutscher Kulturöffentlichkeit: Während es international eine zwar leider selten koschere, aber dann doch immerhin große Debatte um die Zukunft des Kommunismus gibt – Badiou, Žižek, Douzinas, Lazzarato etc. –, kommt die nationale Theoriedebatte über digitale Technik, Internet, NSA, Hirnforschung und asoziale bzw. antisozialistische Anweisungen wie »Du musst Dein Leben ändern«, also ›Anthropotechnik‹ nicht hinaus – Lenin kam eben doch nur bis Lüdenscheid. Ach, natürlich muss man da auch sagen: »Gott sei Dank!«)
Wie dem auch sei: in den 1950er und 1960er Jahren, als erstmals von Pop, Popkunst und Popkultur die Rede war, kursierte das Wort »digital« noch ausschließlich als Fachbegriff und bezeichnete nicht mehr als ein bestimmtes physikalisches Vermittlungsverhältnis, nämlich eines, das nicht analog ist. »Typisch für digitale Systeme ist die unstetige, ziffernmäßige Arbeitsweise. Typisch für analoge Systeme, ist die Tatsache, dass verschiedene Systeme durch dieselben mathematischen Gesetzte beschrieben werden … Digital ist eine Sonderform diskreter Arbeitsweise, synonym mit numerisch bzw. ziffernmäßig.« (Karl Steinbuch, ›Die informierte Gesellschaft‹, Reinbek b. Hbg. 1968, S. 151 f.)
Als Fachbegriff war die Rede vom Digitalen dabei noch ausschließlich auf einerseits den experimentellen Bereich wissenschaftlicher Forschung, andererseits industrielle Automationsprozesse durch Computersteuerung bezogen. In der fordistischen Gesellschaft der Nachkriegszeit gehörte – im Westen wie im Osten – die »Digitalisierung« noch relativ disparat in das Spannungsfeld grundsätzlicher Arbeitsteilung von Hand- und Kopfarbeit. In den Fabriken dachte niemand an Visionen der »künstlichen Intelligenz«, sondern lediglich an Rationalisierung der industriellen Produktion: ohnehin war die fabrikmäßige »Handarbeit« längst der Mechanisierung unterworfen, die computergesteuerte Robotik war nur eine technologische Konsequenz. Damit verlängerte sich die Entfremdung der Arbeit (vgl. die Beiträge von Alfred Sohn-Rethel, Hans-Dieter Bahr, André Gorz u. a. in: Richard Vahrenkamp [Hg.], ›Technologie und Kapital‹, Ffm. 1973). Marxistisch orientierte Theorien diskutierten die Automatisierungsprozesse, die heute auch dem Stichwort »Digitalisierung« subsumiert werden, noch materialistisch als Frage des Zusammenhangs zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften; allerdings blieben die Debatten fixiert auf das schematische Klassenverhältnis, adressierten als Subjekt den »Arbeiter« (hier beginnt die Debatte um Marx’ Begriff des »general intellect«, die sich über den Operaismus bis zu den Theorien der immateriellen Arbeit wie auch Krisentheorie fortsetzt). Verbunden war diese Kritik der Automatisierung der Produktion – nicht zuletzt durch die Wiederaufnahme des Marxschen Entfremdungstheorems, aber auch durch zum Beispiel Sohn-Rethels Großentwurf ›Geistige und körperliche Arbeit‹ (Ffm. 1970) – mit Ideologiekritik, einschließlich einer Wissenschaftskritik (die als kritische Theorie noch ganz anders gelagert war als die Untersuchungen zur Epistemologie, wie sie etwa Foucault in dieser Zeit vorlegte; vgl. insb. Jürgen Habermas, ›Technik und Wissenschaft als ›Ideologie‹‹, Ffm. 1968, dann auch noch einmal Sohn-Rethel, ›Warenform und Denkform‹, Ffm. 1978). Grundsätzlich blieb damit diese marxistisch orientierte Kritik der »Digitalisierung« eingebettet in eine Kritik der Politischen Ökonomie, die schließlich in ihren klugen Varianten immer auch eine Auseinandersetzung um Kommodifizierung und Verwertungslogik war. Der Befund einer in sich widersprüchlichen kapitalistischen Klassengesellschaft rahmte das Thema »Digitalisierung« (»Computerisierung«, »Automatisierung«, »Rationalisierung« etc.).
Abgelöst wurde diese marxistisch orientierte Auseinandersetzung mit den neuen Technologien in den 1970er und 1980er Jahren nicht zuletzt durch die Postmoderne und der mit dem Begriff der »post-industrial society« verbundenen These vom Ende der Klassengesellschaft (Touraine, Bell u. a.). Lyotard nennt das 1979 in seinem Bericht ›Das postmoderne Wissen‹ die »informierte Gesellschaft«.
Die Kritik der politischen Ökonomie wird durch eine affirmative Analytik der »Digitalisierung« ersetzt; das Mensch-Maschine-Verhältnis wird jetzt kaum noch in Bezug auf die speziellen Produktions- und allgemeinen Lebensbedingungen (Entfremdung, Verdinglichung etc.) untersucht, sondern in Hinblick auf solipsistische oder kollektivistische Stereotypen des »modernen Menschen« mit Topoi wie »Individualisierung«, »Persönlichkeit«, »Charakter«, »Innerlichkeit« aber auch »Rolle«, »Verhalten«, »Masse« verknüpft; die Vorläufer dieser positivistisch oder kulturkonservativ orientierten Auseinandersetzung mit der »Digitalisierung« sind etwa Arnold Gehlen (›Die Seele im technischen Zeitalter‹, 1957) oder Alvin Toffler (›Der Zukunftsschock‹, 1970). (Ambivalent spiegeln sich diese Auseinandersetzungen auch in der Sciencefiction wieder, bei Asimov, Lem oder Clarke; kritisch zu würdigen wäre in diesem Zusammenhang Flechtheims Futurologie. Günther Anders lieferte mit seiner ›Antiquiertheit des Menschen‹ 1956 eine interessante, leider vollständig – wahrscheinlich durch den Hype um Baudrillards Simulationstheorie – verdrängte Verbindung aus Technikkritik und Kritik der politischen Ökonomie. – Nichtsdestotrotz hat die nicht-marxistische Auseinandersetzung mit »Digitalisierung« in den letzten Jahren durch die Diskussionen um Norbert Wiener und die Kybernetik eine Revision erfahren …
(Auszug aus: Behrens, ›Digitale Frist. Computer. Pop. (Beta-Version)‹, in: ›Bug Report. Digital war besser‹, testcard #24, Mainz 2014, S. 42 bis 45.)
(862)