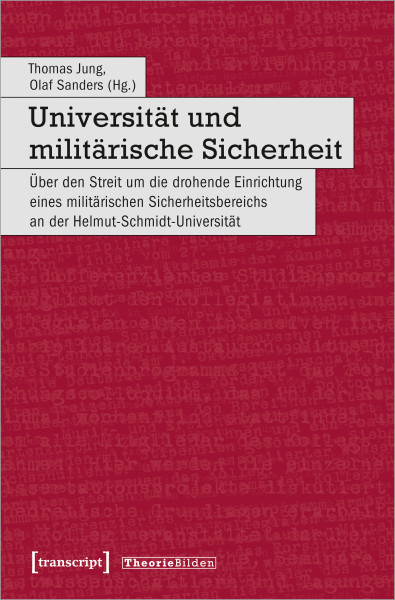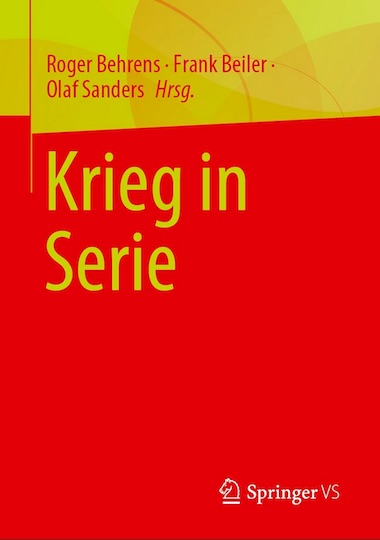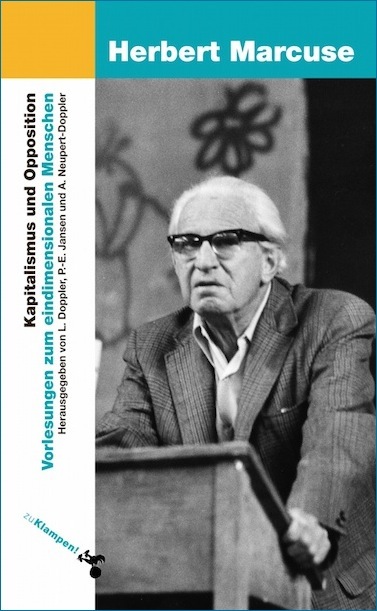
Um der Hoffnungslosen willen
Herbert Marcuse, ›Kapitalismus und Opposition. Vorlesungen zum eindimensionalen Menschen. Paris, Vincennes 1974‹, hg. von Lisa Doppler, Peter-Erwin Jansen, Alexander Neupert-Doppler, zu Klampen! Verlag: Springe 2017, 160 S. brosch. (235)
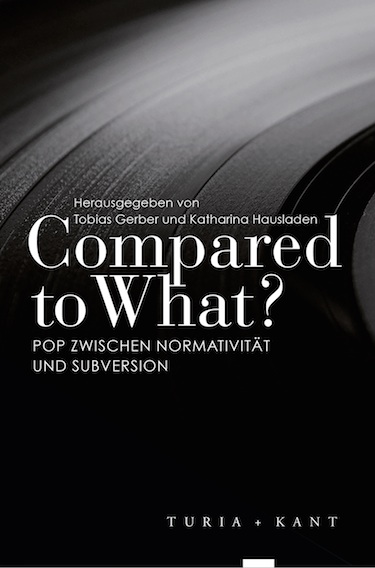
Pop zwischen Subversion
Gerade erschienen: Tobias Gerber und Katharina Hausladen (Hg.), ›Compared to What? Pop zwischen Normativität und Subversion‹, Turia + Kant: Wien 2017 (264)
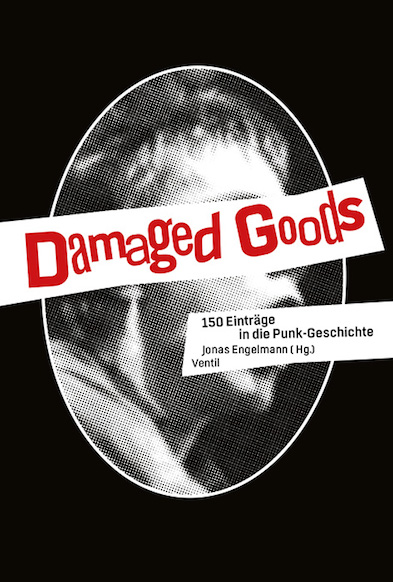
The Years Punk broke …
Gerade erschienen:
Jonas Engelmann (Hg.), ›Damaged Goods. 150 Einträge in die Punk-Geschichte‹, Ventil Verlag: Mainz 2016, 392 S. brosch. mit zahlr. Abb.
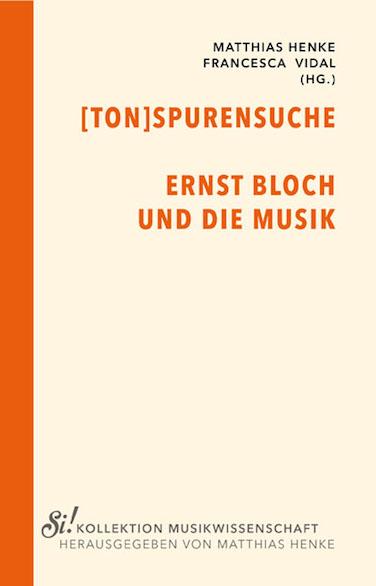
Tonspurensuche
Als Blochs Hauptwerk ›Das Prinzip Hoffnung‹ in drei Bänden 1954, 1955 und 1959 erscheint, konstituiert sich eine neue Kultur, die sich programmatisch auf die Zukunft richtet: Ausgehend von der (britischen) Pop-Art entwickelt sich die Popkultur (initiale Ausstellung in London 1956: ›This is Tomorrow‹); Musik – Rock ’n’ Roll, Soul, ergo Popmusik – wird schnell zur neuen Leitkunst. In Blochs Philosophie schimmert einiges an Motiven durch, die sich auch im Pop und der Popmusik wiederfinden lassen – zumindest wenn man sich drauf einlässt, diese Motive auch zu finden, zumal in Hinblick auf das Grundmotiv Hoffnung. Mithin ist dieses Sich-Einlassen gerade deshalb möglich, weil das Verhältnis von Bloch und Pop mehr als disparat bleibt – ja, tatsächlich haben Bloch und Pop wenig miteinander zu tun (gehabt), schließlich gar nichts, was die Popmusik angeht. Der Beitrag versucht allerdings nichtsdestotrotz Ernst Blochs Philosophie, auch Musikphilosophie, mit Pop und Popmusik zusammenzubringen – oder wenigstens zusammen zu hören.
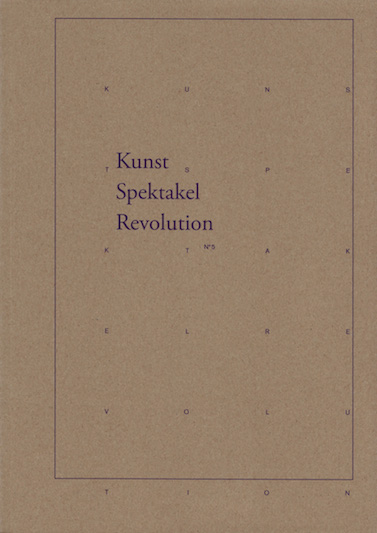
Kunst Spektakel Revolution N°5
Gerade aus dem Druck kommt:
Arbeitsgruppe Kunst und Politik im Bildungskollektiv (Hg.),
›Kunst Spektakel Revolution #5. Zum Verhältnis von Kunst, Politik und radikaler Gesellschaftskritik‹.
Wie immer in konsequenter Gestaltung von: Julian Krischker, Schroeter und Berger (Berlin).
Erschienen im Katzenberg Verlag: Hamburg 2016, ISBN: 978-3-942222-07-5.
Format: 29,71 x 21,01 cm, 112 Seiten, brosch.
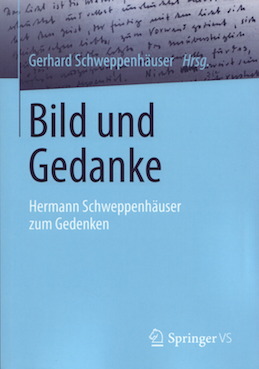
Bild und Gedanke
Gerade erschienen: Gerhard Schweppenhäuser (Hg.), ›Bild und Gedanke. Hermann Schweppenhäuser zum Gedenken‹, Springer VS: Wiesbaden 2017. Darin mein Beitrag ›Radikale Aufklärung‹, S. 43–50. (176)
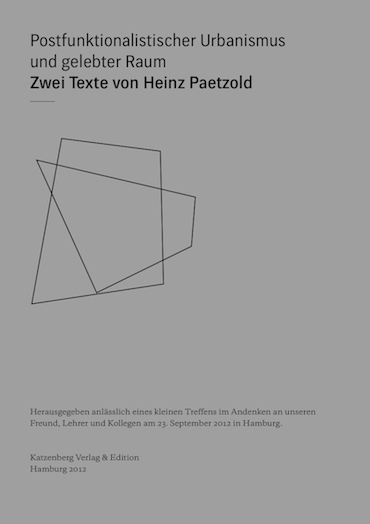
Postfunktionalistischer Urbanismus
und gelebter Raum
Heinz Paetzold hatte sich über die Jahrzehnte auch Hamburg als gelebten Raum erschlossen, mochte es, durch die verschiedenen Zonen der hanseatischen Innenstadt zu flanieren, liebte ausgedehnte Spaziergänge an der Alster oder am Elbufer entlang. Mit seinen Erkundungen setzte er gleichsam fort, was Jahrzehnte zuvor Ernst Cassirer, Aby Warburg oder Martha Muchow in und an Hamburg entdeckten, bevor auch hier der nationalsozialistische Terror losschlug; die Spuren, die hier noch zu finden sind, aktualisierte Paetzold mit seinem Programm einer transzendentalkritischen Kulturphilosophie, an der er seit den späten neunzehnhundertsiebziger Jahren arbeitete.
(Editorische Notiz zu zwei Texten von Heinz Paetzold.)
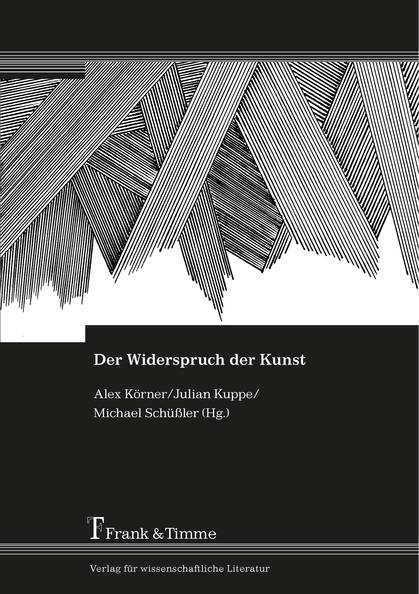
Der Widerspruch der Kunst
Ist Kunst von Gebrauchsprodukten, Kitsch und Reklame nicht mehr zu unterscheiden oder kann sie immer auch ein »Anderes« gegenüber der Gesellschaft darstellen? Den Umgang mit den Widersprüchen, denen die Kunst unausweichlich ausgesetzt ist, untersuchen die elf Beiträge des vorliegenden Sammelbandes und geben dabei Auskunft über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaftskritik in der Kulturindustrie.